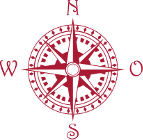Schlesien
Lande beiderseits der Oder zwischen Böhmen und Mähren bzw. Polen, benannt nach dem Volk der Silingen, das in slawischen Kleinstämmen aufging. Sie bilden keine naturräumliche Einheit und waren Jh.e lang auch in politischer Hinsicht keine geschlossene und gleich bleibende Größe. (I) Der im 10. Jh. um sie einsetzende Streit zwischen böhmischen Přemysliden und polnischen Piasten – im Jahr 1000 wurde unter Bolesław I. Chrobry eine selbständige polnische Kirchenprovinz (Erzbistum Gnesen [Gniezno/PL]) gegründet, der auch das Suffraganbistum Breslau (Wrocław/PL) angehörte – wurde erst 1137 durch Verzicht der ersteren auf die Oberhoheit mit Ausnahme des Glatzer Lands, von Leobschütz (Glubczyce/PL), Jägerndorf und Troppau gelöst. Doch konnte sich Sch. von Polen langsam wieder lösen. Mit Beginn des 13. Jh.s datiert die Auseinanderentwicklung des oberschlesischen Raumes unter den Herzögen von Oppeln (Opole/PL) sowie Mittel- und Niederschlesiens unter den in Breslau residierenden Herzögen von Sch. In der ersten Hälfte des 14. Jh.s erreichte die Aufsplitterung Sch.s einen ersten Höhepunkt: 1327 bestanden auf dem Territorium 16 Einzelfürstentümer. Wladysław II., der erste schlesische Herzog, war mit Agnes, einer Tochter des BabenbergersLeopold III. verheiratet. Hzg. Heinrich I. hatte Hedwig aus dem Geschlecht der Andechs-Meranier zur Frau, sie wurde bereits ein Vierteljahrhundert nach ihrem Tod heilig gesprochen und gilt noch heute (2005) als Patronin Sch.s. Seit dem 14. Jh. können die sch.en Piasten als Deutsche betrachtet werden, bei Hofe wurde die sch.e Mundart gesprochen. Die enge Verflechtung der Herzöge von Breslau mit den Přemysliden aber wurde ausschlaggebend für die politische Orientierung: bis 1330 akzeptierten alle sch.en Teilfürsten die böhmische Lehenshoheit. Mit dem 1335 geschlossenen Vertrag von Trentschin (Trencsén, Trenčín/SK) gab der polnische König alle Ansprüche auf sch.e Territorien auf. Von da an blieb die sch.isch-polnische Grenze bis zur Mitte des 20. Jh.s im Wesentlichen stabil.Neben der territorial-politischen Entwicklung im Hochmittelalter wurde für die gesamte weitere Geschichte Sch.s die „Kolonisation zu deutschem Recht“ ein bestimmender Faktor. Sie setzte im ausgehenden 12. Jh. ein und war um 1300 weitgehend abgeschlossen. Die Siedler kamen v. a. aus den östlichen Gebieten Deutschlands, aber auch aus Flandern und Wallonien. Gleichzeitig kam es zu Klostergründungen durch Zisterzienser, Franziskaner, Dominikaner, aber auch Johanniter, Deutschordensritter und Prämonstratenser. Unter dem Luxemburger Karl IV. wurden die sch.en Einzelterritorien 1348 der „Böhmischen Krone“ inkorporiert, damit gehörte Sch. bis 1742 auch dem Römisch-Deutschen Reich an. Die wirtschaftliche und kulturelle Blüte unter den Luxemburgern fand mit dem Ausbruch der Hussitenkriege ein jähes Ende, der sich entwickelnde politische Regionalismus lockerte die Bindungen zu Prag und konzentrierte sich auf inner-sch.e Probleme. Hzg. Albrecht V. von Österreich vereinigte 1438 zum erstenmal für kurze Zeit die drei Länderkomplexe Österreich, Böhmen und Ungarn in einer Hand. Das Erbrecht seines Sohnes Ladislaus Posthumus wurde aber nur in den Nebenländern Mähren, Sch. und den Lausitzen anerkannt, während in Böhmen der Aufstieg des „utraquistischen“ Georg von Podiebrad begann. Als nach dessen Tod die Doppelwahl von Matthias Corvinus und dem polnischen Königssohn Wladysław II. Jagiello 1479 legalisiert wurde, erhielt Matthias die Nebenländer, Wladysław II. Böhmen. Matthias setzte einen politischen Konzentrationsprozess in Gang: ein „Oberlandeshauptmann“ aus den Reihen der sch.en Fürsten und der „Fürstentag“ bildeten gemeinsam die tragende Säule des sch.en Ständestaates.
Wie in anderen Territorien des Reiches auch, waren die Jahrzehnte nach der Übernahme der Herrschaft durch die Habsburger nach der Schlacht von Mohács/H (1526) vom Dualismus zwischen Ständeherrschaft und Königsmacht geprägt. Die Reformation hatte auch auf die sch.en Territorien übergegriffen, 1526 war in Liegnitz (Legnica/PL) die erste (allerdings nur kurzlebige) evangelische Univ. gegründet worden. Trotz des Augsburger Religionsfriedens blieb die konfessionelle Koexistenz lange Zeit erhalten. Der nach 1600 zunehmende Druck der Gegenreformation und des Königtums gegen ständische Mitspracherechte führte 1609 zu einem ersten Widerstandsbündnis der sch.en Fürsten und Stände mit den böhmischen Protestanten. Das daraufhin von K. Rudolph II. angestrebte ständisch-föderative Staatsmodell scheiterte mit der Niederlage des „Winterkönigs“ Friedrich V./I. in der Schlacht am Weißen Berg (1620). In der Folge verfestigte sich das katholisch-kaiserliche Lager, von den Kampfhandlungen des Dreißigjährigen Krieges war Sch. jedoch vergleichsweise geringer betroffen. Im Westfälischen Frieden (1648) wurde den evangelisch gebliebenen sch.en Fürsten und der Stadt Breslau das Recht freier Religionsausübung zugestanden, trotzdem kam es zu verstärkten Rekatholisierungsmaßnahmen. 1702 wurde in Breslau die Jesuiten-Univ. Leopoldina gegründet, die zum geistigen Mittelpunkt der Gegenreformation werden sollte. Doch schon vorher war das wissenschaftliche und kulturelle Leben in Sch. hoch entwickelt gewesen (vgl. z. B. die sch.e Barockdichtung eines Martin Opitz, Angelus Silesius, Andreas Gryphius). Die staatlicherseits betriebene Religionspolitik führte dazu, dass sich die Protestanten immer häufiger auch an ausländische Mächte um Hilfe wandten. In einer schwierigen außenpolitischen Situation schloss K. Joseph I.mit Schweden 1707 die Altranstädter Konvention, die den Protestanten Kirchen und Schulen zurückgab und ihre Benachteiligung gegenüber Katholiken beenden sollte. Hatten sich die Habsburger nach 1648 nur wenig um den Ausbau der landesfürstlichen Macht des Kaisers im Lande und um Angleichung der ständischen Vielgestaltigkeit an die Verhältnisse in den anderen Erblanden bemüht, rückte erst die genealogische Krise des Hauses nach dem Tod K. Karls VI. Sch. wieder ins Zentrum des Interesses: Nach den preußischen Siegen im Ersten Sch.en Krieg (1740–42) wurde Sch. im Berliner Frieden geteilt; bei der habsburgischen Monarchie verblieben nur die Fürstentümer Teschen, ein Teil von Troppau-Jägerndorf und ein Drittel des ehemaligen Bistumslandes Neiße. Der Zweite Sch.e Krieg und der sog. Siebenjährige Krieg änderten daran nichts mehr. Während Preußen sofort daran ging, das Land in administrativer, politischer und militärischer Hinsicht nach dem Vorbild der altpreußischen Provinzen umzugestalten und in den neuen Staatsverband zu integrieren, wurde in dem bei den Habsburgern verbliebenen Gebiet die ständische Verfassung nicht gänzlich aufgehoben und blieb bis 1848 in Kraft. Doch auch Maria Theresia war um eine Modernisierung der Verwaltung bemüht. Sie beauftragte damit Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz, der seine am schlesischen Beispiel erprobten Vorschläge dann auch in allen anderen Erbländern zur Anwendung brachte. K. Joseph II. schloss Österreichisch-Sch. und Mähren im Brünner Gubernium zu einer einzigen landesfürstlichen (= staatlichen) Verwaltungseinheit zusammen, 1849 erhielt Sch. wieder seine verwaltungsmäßige Unabhängigkeit und staatsrechtlich eigenständige Stellung als Kronland.
Die Trennung vom preußischen Hinterland hat jedoch nicht nur das wirtschaftliche Leben Österreichisch-Sch.s nachhaltig beeinflusst, die starke Industrialisierung in der 2. Hälfte des 19. Jh.s führte dazu, dass der Anteil der Arbeiterschaft in Sch. höher war als etwa in Böhmen. Etwas weniger als die Hälfte der Bevölkerung sprach deutsch, rund 30 % gaben bei der Volkszählung 1910 polnisch und etwas über 20 % tschechisch als Umgangssprache an. Tatsächlich dürften die Verhältnisse aber komplizierter gewesen sein. Diese brachten es mit sich, dass nach dem Ersten Weltkrieg das Teschener Gebiet erneut geteilt wurde. Nachdem es zu militärischen Auseinandersetzungen gekommen war, verfügten die Siegermächte 1920, dass die Gegend östlich des Flusses Olsa dem polnischen Staat zugesprochen wurde, während der Westteil der Stadt Teschen (Cieszyn/PL bzw. Český Těšín/CZ) und das wichtige Kohlegebiet ebenso wie das ganze übrige ehemalige Österreichisch-Sch. im Westen des mährischen Winkels an die Tschechoslowakische Republik fielen. 1938 kam das gesamte Teschener Gebiet wieder an Polen, doch 1945 wurde der Zustand von 1920 wiederhergestellt. Auch das preußische Oberschlesien wurde nach 1918 zum Austragungsort militärischer Auseinandersetzungen zwischen Polen und Deutschen. Trotz einer Volksabstimmung, in der sich die Bevölkerung mehrheitlich für den Verbleib bei Deutschland entschied, wurde Oberschlesien geteilt, wobei man die lokalen Abstimmungsergebnisse zwar berücksichtigte, im Wesentlichen aber nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorging. 1939 wurde Oberschlesien wieder Teil des Deutschen Reiches, bei der Verschiebung der polnischen Westgrenze nach 1945 fiel ganz Sch. an Polen.
Literatur
J. Bahlcke, Sch. u. die Schlesier 1996; N. Conrads (Hg.), Sch. 1994; L. Petry et al. (Hg.), Gesch. Sch.s, 2 Bde. 21988.
J. Bahlcke, Sch. u. die Schlesier 1996; N. Conrads (Hg.), Sch. 1994; L. Petry et al. (Hg.), Gesch. Sch.s, 2 Bde. 21988.
(II) In den Klöstern Sagan (Żagań/PL), Breslau (Wrocław/PL), Leubus (Lubiąż/PL), Rauden (Rudy/PL), Kamenz/D, Heinrichau(Henryków/PL) u. a. stand selbstverständlich der Gregorianische Choral im Mittelpunkt der täglichen Gottesdienste. Zu den ältesten Musikdenkmälern Sch.s gehören linienlos neumierte (Neumen) Fragmente von Gradualien aus Breslau und anderen Klöstern, die bis ins 11. Jh. zurückreichen und offensichtlich von den eingewanderten Mönchen mitgebracht worden waren. Um 1250 wurden in Sch. mehr und mehr selbst Choralbücher angefertigt, wobei sich die Schreiber, je nach den Mutterklöstern, entweder an französischen oder deutschen Vorbildern, diese nun in deutscher gotischer Schrift, orientierten. Gleichfalls abhängig von ihren Gründern prägte sich auch der Choraldialekt aus. Während Zisterzienser und Prämonstratenser, Kreuzherren und vermutlich auch Franziskaner den „romanischen“ pflegten, wurde in den Kollegiatsstiften Glogau(Głogów/PL) und Neisse (Nysa/PL) wie in den Stadtpfarrkirchen der sog. „germanische“ Choraldialekt gesungen. Sch.e Eigenprägung für die Hl. Hedwig, die schlesische Schutzpatronin, verraten Neukompositionen von gregorianischen Alleluja Versen, ferner Responsorien, Lamentationen und Evangeliumstexte, die durch Ruhe und Bedachtsamkeit im Formalen sowie durch schwerfällige Melodik gekennzeichnet sind.
Der europäische Minnesang berührte auch die Breslauer Hofhaltung. Hzg. Heinrich I. der Bärtige (1201–38) sang selbst in deutscher Sprache, der in Prag erzogene Hzg. Heinrich IV. (1252/53–90) dichtete zwei Lieder, die die Große Heidelberger Liederhandschrift ohne Melodien überliefert; sie sind textlich und motivisch der Spätphase des deutschen Minnesangs zugehörig. Um 1256/66 rühmte bereits Tannhäuser (Leich VI) und rückschauend Frauenlob (Heinrich v. Meißen) um 1311 (Spruch 135) die Sängerfreundlichkeit des Breslauer Hofes.
Breslau dürfte auch relativ früh mit Mehrstimmigkeit bekannt geworden sein. Quellenfragmente aus Breslau und dem Kloster Sagan, hier nicht weniger als zehn Kompositionen der französischen Ars nova, die Mehrzahl mit Liebeslyrik textiert, belegen dies. 1327 wäre mit dem Prager Hofstaat ein Besuch G. de Machauts in Breslau möglich. Wie Nachrichten aus Sagan und Hirschberg (Jelenia Góra/PL) bezeugen, muss das mehrstimmige Singen in der neuen motettischen Art im 15. Jh. bereits eine gewisse Tradition gehabt haben. Neben dieser kunstvollen Darbietung hielten sich in Sch.noch lange Zeit einfache organale Techniken. Frühestes Beispiel ist das von dem Minoriten Nicolaus von Cosel (ca. 1390–ca. 1431) aufgezeichnetePulchrum Evangelium sowie weitere mitunter vielsprachige (lateinisch, deutsch, tschechisch, polnisch) Gesänge. Bis gegen 1500 wurden die weihnachtliche Lectio Jesaiae Prophetae und Liber-generationis-Vertonungen meist im schlichten zweistimmigen organalen Satz gesungen. Die Bewahrung dieser musikalischen Praktiken mag mit der bekannten Constitutio des Papstes Johannes XXII. von 1326 Docta Sanctorum Patrum zusammenhängen, die sich gegen das Eindringen des Lasziven in den mehrstimmigen kirchlichen Gesang, gegen die Benutzung weltlicher Melodien in der Motette und schließlich gegen die Unkenntlichmachung des Gregorianischen Gesangs in der mehrstimmigen Komposition wandte. Noch 1480 erinnert die Saganer Abtchronik an diese Constitutio, ohne jedoch das Vordringen der organisierten Mehrstimmigkeit aufhalten zu können. Aus dem böhmisch-schlesischen Grenzgebiet dürfte die seit 1440 in Kremsmünster aufbewahrte Hs. CC 312 (spätes 14. Jh.) stammen, die einige zweistimmige Motetten des sog. Engelberger Typs enthält. Für den ebenfalls enthaltenen Mensuraltraktat Pro facili informacione hat A. Kellner die Hilfsbezeichnung „Brieger Anonymus“ eingeführt.
Dass Mehrstimmigkeit bereits in der 2. Hälfte des 15. Jh.s in Sch. weit verbreitet war, dokumentiert v. a. das sog. Glogauer Liederbuch (D-B 40098, jetzt in Bibl. Jag. Kraków) von ca. 1478/80. Es enthält 192 fast nur dreistimmige Sätze, 165 lateinisch textierte liturgische Kompositionen, 73 deutsche Lieder und 55 Tanz- und Instrumentalsätze, die die Rezeption burgundisch-niederländischer Vorbilder widerspiegeln. Ihr c. f. liegt überwiegend im Tenor, gelegentlich aber auch im Diskant. Seine 3 Stimmbücher waren für einen kleinen, musikalisch gebildeten Kreis, nicht für den Gottesdienst bestimmt und gehören auch zu den ältesten Quellen für Quodlibets. Von einer geübten Hand fast fehlerfrei notiert, vermutet man heute P. Wilhelmi aus Graudenz als Schreiber, der sie als Auftrag oder aus Gefälligkeit angefertigt habe. Für seine Persönlichkeit sprechen die „Weltläufigkeit“ des Repertoires, die zahlreichen Querverbindungen zu bedeutenden Quellen der Zeit (Trienter Codices, Liederbuch des Hartmann von Schedel) sowie die profunde Sachkenntnis der Niederschrift.
Mit der zunehmenden Rezeption der Renaissance-Einflüsse des niederländischen Stils steht Sch. um 1500 im Gleichklang mit Mittel- und Süddeutschland. Spiegelbild dieser Entwicklung ist der Breslauer Kodex Mf. 2016, der, aus einem unbekannten Kloster im schlesisch-mährischen Grenzraum stammend, nach der Säkularisation nach Breslau kam. Er gehört zu einer Gruppe von fünf repräsentativen, im Inhalt gelegentlich miteinander korrespondierenden Individualhandschriften, die in Sachsen, Süddeutschland und Böhmen geschrieben wurden. Er enthält 93 verschiedene mehrstimmige geistliche Kompositionen, 6 Messen und 87 Motetten sowie ein weltliches Quodlibet und ein unbezeichnetes Stück. Der Anteil niederländischer Kompositionen ist beträchtlich; von deutschen Musikern konnten sechs Werke identifiziert werden. Die Handschrift ist ein getreues Spiegelbild dessen, was man in Sch. um 1500 kannte und schätzte. Altes in archaisch anmutender Dreistimmigkeit steht neben fortschrittlicher Durchimitation des vierstimmigen Satzes. Der gregorianische c. f. ist unveränderliche Richtschnur des Komponierens.
Mit Th. Stoltzer (ca. 1470–1526) tritt der erste bedeutende Musiker in die sch.e Geschichte.
Neben Süddeutschland gehörte Sch. bereits im Mittelalter zu den bedeutenden Orgelprovinzen. Erwähnt werden Orgeln in der Vita S. Hedwigis (1353), in Görlitz (Zgorzelec/PL, 1390), im Kloster Sagan eine große und eine kleine, im Breslauer Dom und einigen anderen großen Kirchen. Das älteste Fragment von notierter Orgelmusik stammt aus Sagan, die früheste deutsche Orgeltabulatur (ca. 1425) überhaupt. Aus dem Breslauer Dominikanerkloster stammen Liedbearbeitungen und Fundamenta für Orgel. Von den Orgelbauern gehörte Stephan Kaschendorff aus Breslau zu den ersten seines Fachs in Deutschland; er hat auch in Nördlingen/D, Nürnberg/D, Erfurt/D und Augsburg/D gebaut. Die große Zeit des Orgelbaus in Sch. begann dann Ende des 17. Jh.s mit Eugenio Casparini. Der vorübergehend zu einem Schlagwort gewordene Ausdruck „polnische Tänze“ geht auf die 1555 in Breslau erschiene zweibändige Sammlung Etlicher gutter Teutscher und Polnischer Tantz der Brüder Bartholomäus (* 18.8.1518 [Ort?], † 27.7.1585 Breslau) und Paul Hess (Hessen) zurück, die aus der Steiermark stammten und hier als Stadtpfeifer, aber auch Hersteller von Blasinstrumenten tätig waren.
Luthers Reformation fasste in Sch. schnell Fuß. Dank der Beharrlichkeit des schlesischen Reformators Johann Heß bekannte sich fast die ganze Landeshauptstadt zum Luthertum. Nur der Dom und einige wenige Kirchen blieben katholisch. Gegen Ende des 16. Jh.s war, mit Ausnahme von Oberschlesien, der größte Teil Sch.s evangelisch. Die althergebrachte gottesdienstliche Musik wurde, abgesehen von der Einführung des deutschsprachigen Gemeindegesangs, von der Reformation nur wenig tangiert. So bestand zwischen den protestantischen und katholischen Bereichen noch eine enge Literaturgemeinschaft. Man vermied Härten und beließ liebgewordene Traditionen. Gegen Ende des 16. Jh.s wurden die Werke von O. di Lasso und J. Gallus, der um 1578 in Sch. weilte, häufig gesungen. Die Einrichtung der Lateinschulen an den größeren evangelischen Kirchen förderten die Musikpflege ungemein. Von den schlesischen Komponisten des späten 16. Jh.s ragt der talentierte Johannes Knöfel (ca. 1540–1617?) hervor. Er wirkte zunächst in Goldberg (Złotoryja/PL) und Liegnitz, später in Heidelberg/D und Prag und scheint in Kärnten gestorben zu sein. Mit seinem Breslau gewidmeten Cantus choralis wollte er der fortschreitenden Auflösung der lateinischen Liturgie Einhalt gebieten. Kompositorisch steht er in der Nähe von O. di Lasso. Exponent der katholischen Kirchenmusik der Gegenreformation in Sch. wurde der Görlitzer Konvertit Johannes Nucius (1556–1620). Er konvertierte, wurde Mönch im Kloster Rauden und 1591 zum Abt des Klosters Himmelwitz gewählt. In zwei Drucken von 1591 und 1609 veröffentlichte Nucius 102 fünf bis achtstimmige Motetten in einem klangvollen, chromatisch gefärbten Satz, der sich an G. Gabrieli und O. di Lasso anlehnt und ganz im Dienste einer lebendigen Wortverkündigung steht. Fünf Kompositionen ist der deutsche Text unterlegt – ein bemerkenswertes Zeichen von Kompromissbereitschaft eines katholischen Abtes. Seine 1613 gedruckte theoretische Schrift Musices poeticae [...] praeceptiones bringt erste Ansätze zur Figurenlehre (Rhetorik). Im Zeitalter des Hochbarocks fehlten im evangelischen wie katholischen Bereich große kompositorische Begabungen. Dank der verlegerischen Tätigkeit von Ambrosius Profe (1589–1661) wurden Breslau und Sch. jedoch mit den Werken führender italienischer Musiker, mit dem Concertostil Ludovico da Viadana u. a. vertraut. Heinrich Schütz besuchte 1621 Breslau. Mit seinen deutschsprachigen Werken begann auch in Sch. eine eigenständige geistliche evangelische Musik. Der dreißigjährige Krieg verarmte die Bevölkerung und beschränkte die Pflege der Kirchenmusik auf ein Minimum. Erst nach dem Krieg wurde die darniederliegende Musik am Breslauer Dom aufgrund zweier großer Stiftungen wieder konsolidiert. Einen eindrucksvollen Widerhall in ganz Deutschland fand jedoch im 17. Jh. das evangelische Kirchenlied dank Martin Opitz und seiner Dichterschule. Johann Heermann (1585–1647) gilt als der bedeutendste Kirchenlieddichter zwischen Luther und Paul Gerhardt. Auch das katholische Kirchenlied erlebte eine Blütezeit. Die Dichtungen des Konvertiten Angelus Silesius (1624–77) griffen beide Konfessionen auf. Georg Joseph, der in Diensten des Breslauer Fürstbischofs stand, schrieb 205 Melodien zu seiner Heiligen Seelenlust, zu geistlichen Sologesängen für Hausandachten. Mehr in der Stille, aber mit beträchtlicher Resonanz, wirkten Jesuiten von Böhmen und Österreich aus in zahlreichen sch.en Städten seit dem späten 16. Jh. im Sinne der Gegenreformation. Sie gründeten überall Schulen, in denen die Vokal- und Instrumentalmusik gepflegt wurde, auch kleine Gesellschaften, die als Vorläufer des späteren Kirchenchors anzusehen sind. Schüler und Bürger wetteiferten bei der musikalischen Ausgestaltung des Gottesdienstes. Gelegentlich traten auch Patres als Komponisten hervor. Besonders die rekatholisierte Grafschaft Glatz, die zum Prager Bistum gehörte, trat in musikalischer Hinsicht beispielgebend für ganz Niederschlesien hervor.
Die evangelische Kirchenmusik bewegte sich zu Beginn des 18. Jh.s in bescheideneren Dimensionen als am Ende des Hochbarocks. Unter den komponierenden Kantoren war Johann Georg Hoffmann (1700–50) an St. Elisabeth in Breslau am produktivsten. In seinen Werken stand die „vernünftige Melodie“ im Vordergrund. Der Breslauer Organist Georg Gebel d. Ä. (1685–1750) schrieb als Altersgenosse J. S. Bachs Klavierkonzerte, 24 Praeludien und Fugen und Choräle, die alle verloren gegangen sind. Viele Kantoren und Organisten waren weitgehend nur reproduktiv tätig. Im katholischen Bereich ist neben zahlreichen Kleinmeistern der Saganer Chorherr Carl Ritter (ca. 1695–1742) der einzige, dessen sechs Messen und 16 Arien auf lateinische Texte gedruckt wurden. Georg Clement (1710–94) wurde zum Domkapellmeister in Breslau berufen und komponierte eine Reihe sorgfältig gearbeiteter Werke.
Wenn schon Sch. seinerzeit nur einen relativ bescheidenen Beitrag zur Entwicklung der Kirchenmusik zu leisten vermochte, so trat es doch neben Böhmen in Lautenspiel und der Lautenkomposition rühmlich hervor. Die meisten Lautenisten wanderten mangels eines schlesischen Wirkungsfeldes an mittel- und westdeutsche Höfe aus. Esaias Reusner d. J. (1636–79) wirkte zeitweilig am Hof zu Brieg (Brzeg/PL), spielte mit Anerkennung vor K. Leopold I. in Wien und wurde in den letzten Lebensjahren Kammerlautenist des Großen Kurfürsten in Berlin. Diesem bedeutenden Komponisten der Lautensuite folgte u. a. um 1700 der in Brieg geborene, in Breslau lebende Silvius Leopold Weiß (1684–1750). Er fand nach Engagements in Düsseldorf/D und beim polnischen Prinzen Alexander Sobieski in Rom 1718 am Dresdner Hof als höchstbezahlter Kammermusiker seine Lebensstellung. Sein ungemein kunstfertiges Spiel, seine Improvisationen sowie seine über 100 Suiten und Fantasien, die z. T. das Niveau von J. S. Bach besitzen, wurden von zahlreichen Zeitgenossen gerühmt. Weiß errang europäische Bedeutung.
Nach Eugenio Casparini (1623–1706) und dessen Sohn Adam Horatius (1676–1745), die beide die berühmte Sonnenorgel in Görlitz bauten, konnte Sch. den hohen Standard im Orgelbau auch im 18. Jh. halten. Ignatius Mentzel (1670–1730) galt als der beste und zuverlässigste Orgelbauer seiner Zeit. Davon zeugten die Orgeln für Maria auf dem Sande in Breslau, für St. Peter und Paul in Liegnitz und seine größte mit 47 Stimmen für die evangelische Gnadenkirche in Landeshut (Kamienna Góra/PL). Michael Engler d. J. (1688–1760) setzte diese Tradition würdig fort. Seine Orgeln in der Nicolaskirche in Brieg, in der Marienkirche in Grüssau (Krzeszów/PL) und schließlich die 50-stimmige Orgel für St. Elisabeth in Breslau begründeten seinen Ruhm.
Die enge, seit Jh.en gewachsene Bindung Sch.s an Böhmen und Österreich blieb in musikalischer Hinsicht auch nach der preußischen Okkupation 1740 erhalten, ja verstärkte sich noch am Anfang des 19. Jh.s. Die Werke J. Haydns wurden nicht nur in Breslau, sondern auch in manchen Klöstern sehr geschätzt. L. v. Beethovens Symphonien erklangen, sehr zur Freude des Komponisten, unmittelbar nach ihrer UA im Breslauer Konzertleben. Große Verdienste hierbei erwarb sich Domkapellmeister Joseph Ignaz Schnabel (1767–1831), der in Breslau ein stehendes Orchester bildete und überwiegend Werke der Wiener Klassik zur Aufführung brachte. Es dauerte freilich noch volle 30 Jahre, bis in Sch.s Hauptstadt ein privat finanziertes Berufsorchester unter dem Namen Breslauer Orchesterverein werden konnte, aus dem im 20. Jh. dann die staatliche Sch.e Philharmonie erwuchs. Höfische Orchester kleinerer Dimensionen existierten in Verbindung mit einem Theater in Sch. nach den Befreiungskriegen in Oels (Oleśnica/PL), Carlsruhe (Pokój/PL), Pleß (Pszczyna/PL) und anderen Orten nur für relativ kurze Zeit. Eine Ausnahme bildete die 1852 vom Fürsten Konstantin zu Hohenzollern Hechingenauf Schloss Hohlstein bei Löwenberg (Lwówek Śląski/PL) gegründete Kapelle mit 45 Berufsmusikern, die sich unter der Leitung von Max Seifriz bis 1869 besonders den Kompositionen der Neudeutschen Schule widmete.
Die Oper konnte sich im 18. und 19. Jh. in Sch. nur mit Schwierigkeiten etablieren. 1725–34 gastierte in Breslau mit Unterstützung des Adels „eine Bande italienischer Virtuosen“ unter Leitung des venezianischen Maestro Antonio Bioni. Schlesisch war das 20 Mann starke Orchester unter Daniel Treu (1695–1749), der selbst Opern schrieb. Das protestantische Bürgertum stand der italienischen Oper ziemlich verständnislos gegenüber, so dass Bioni bald kapitulieren musste. Im späten 18. Jh. führte C. Ditters v. Dittersdorfin Diensten des Fürstbischofs von Breslau auf Schloss Johannisberg (Jánský Vrch) bei Jauernig (Javorník/CZ) Opern und Operetten auf, die an kleinen Fürstenhöfen von Wanderbühnen in Sch. häufig gespielt wurden. Breslau besaß im frühen 19. Jh. eine ständige Oper, die nach dem schnell gescheiterten jugendlichen Opernchef C. M. v. Weber an erfahrene Theaterpraktiker überging. Immer wieder von finanziellen Krisen geschüttelt, leitete sie Eugen Seidelmann 1830–64 vornehmlich als Mozart-Theater, bis sie 1878 als Stadttheater in öffentliche Leitung überging.
Nach den Befreiungskriegen entstand, wie in ganz Deutschland, auch in Sch. eine breite Laienbewegung. Seit 1816 wurden überall Gesangvereine gegründet, die zunächst nur Männern (Männergesang) vorbehalten blieben. Aus solchen Chorvereinigungen erwuchs 1830 das erste Schlesische Musikfest in Kynau (Zagórze Śląskie/PL), dem in den folgenden 44 Jahren 15 weitere in verschiedenen Städten folgten. 1876 ergriff Bolko von Hochberg (1843–1926) mit der Gründung der Sch.en Musikfeste die Initiative, die bis 1942 26mal, vornehmlich in Görlitz, stattfanden und nicht nur zum Kräftemessen vieler schlesischer Chöre, sondern auch zum Treffpunkt hervorragender Orchester und Dirigenten wurden. Darüber hinaus wurden meist in Breslau Musikfeste veranstaltet, die ausschließlich einem Komponisten wie J. S. Bach, Max Reger oder R. Strauss gewidmet waren. Auf Anregung des Berliner Vorbilds von Carl Friedrich Zelter rief Johann Theodor Mosewius (1788–1858) als erste gemischte Chorvereinigung die Singakademie ins Leben, die vornehmlich der Pflege älterer Musik, später auch der des 19. Jh.s und ihrer öffentlichen Aufführung diente. Diesem Beispiel folgten bald Liegnitz, Neisse, Glogau und andere Städte.
Zentrum der katholischen Kirchenmusik in Sch. war der Breslauer Dom, zugleich auch Hüter der Tradition (1805–1945). In dieser Zeit verwalteten sieben Domkapellmeister das höchste kirchenmusikalische Amt. Sie hatten nicht nur die Musik im Dom zu leiten, sondern auch zu komponieren. Im Mittelpunkt ihrer schöpferischen Bemühungen stand bis 1945 wie in Österreich die orchesterbegleitete Messe, die fester Bestandteil der feierlichen musikalischen Zelebration blieb. Aus dieser „Breslauer Schule“ traten J. I. Schnabel, Moritz Brosig (1815–87) und Siegfried Cichy (1865–1925) kompositorisch hervor. Schnabel hat 210 Werke hinterlassen, allein 17 Messen, die noch ganz im Banne der Wiener Klassik standen. Brosig, der die orchesterbegleitete Messe gegenüber den puristischen Bestrebungen der Cäcilianer hartnäckig verteidigte, schrieb neben zahlreichen Orgelstücken neun Messen, ein Requiem, zwei Vespern und zahlreiche weitere Vokalkompositionen, die, von Fr. Schubert und C. M. v. Weber nicht unbeeinflusst, sehr häufig in der Wiener Hofkapelle, an St. Stephan und in vielen österreichischen Klöstern aufgeführt wurden. Cichys gediegene Werke mit selbständiger Führung des Orchestersatzes griffen Anregungen der geistlichen Kompositionen F. Liszts auf.
In den evangelischen wie katholischen Kirchen der Provinz bestritten Laien einen Großteil der Kirchenmusik. Das auf Berliner Anregungen hin gegründete Königliche akademische Institut für Kirchenmusik der Breslauer Univ. und die Lehrerseminare bildeten die angehenden Lehrer in der Regel auch zu Kantoren aus, die in Dörfern wie Städten die musikalische Volksbildung tatkräftig förderten. An den großen evangelischen Kirchen spielte die Orgelmusik eine wichtige Rolle. Im Zeitalter der romantischen Virtuosität brillierte Friedrich Wilhelm Berner (1780–1827), dessen Spiel schon Felix Mendelssohn Bartholdy bewunderte. Einer der bedeutendsten Organisten seiner Zeit wurde Adolph Friedrich Hesse (1809–63), den Hector Berlioz als „Riesen auf der Orgel“ titulierte. Hesse hat auch viel komponiert. Diese Tradition hat sich auch im 20. Jh. fortgesetzt, z. B. mit Gerhard Zeggert an St. Elisabeth in Breslau, der in mehreren Jahrzehnten vor 1945 nicht weniger als 430 Orgelkonzerte veranstaltete.
In Analogie zu dem großen Orchester der Romantik wurden auch die Orgeln dem neuen Klangideal angepasst. C. F. Buckow aus Hirschberg baute in Böhmen, Prag und Österreich mehrere Orgeln. Die 1858 in der Piaristenkirche Maria Treu (Wien VIII) errichtete dreimanualige Orgel, auf der u. a. auch A. Bruckner spielte, erregte großes Aufsehen. Den Orgelmarkt in Sch. beherrschten um 1900 zwei große Firmen: Sauer in Frankfurt an der Oder/D und Schlag & Söhne in Schweidnitz ( Świdnicabei Zielona Góra/PL). Ihre Instrumente führten zu einer gewissen Uniformierung des Orgelbaus. Im Extremfall entstanden Riesenorgeln wie die der Breslauer Jahrhunderthalle im Jahr 1913 (IV/200), Ausdruck der Gigantomanie jener Zeit. Nach diesen Übersteigerungen setzte nach dem Ersten Weltkrieg mit der „Orgel Bewegung“ eine Rückbesinnung auf die Qualitäten der vor 1800 gebauten Orgeln ein. Die Rekonstruktion der Engler-Orgel in Brieg, weiterer alter Orgeln und behutsame Neubauten zeigten ein Umdenken, das der Zweite Weltkrieg jäh abbrach. 1917 besaßSch. die meisten Orgeln von allen preußischen Provinzen. Aus Jägerndorf stammte die bekannte Orgelbauerfamilie Rieger. Nicht erfüllt haben sich die Hoffnungen auf eine nachhaltigere Bedeutung des Verlag[s] A. Pietsch in Ziegenhals (Glucholazy/PL) für die (auch österreichische) Kirchenmusik.
Auch im frühen 19. Jh. wanderten zahlreiche schlesische Musiker nach Mitteldeutschland, Böhmen, Österreich (z. B. M. Kalbeck, F. Sauer), Polen und Russland aus. Nur wenige kehrten zurück. Einige Schlesier waren in führenden musikalischen Positionen in den USA tätig: Sir Isidor Henschel (1850–1934) stand bis 1884 dem Boston Symphony Orchestra vor. Leopold Damrosch (1822–85) gab als Dirigent und Organisator von Musikfesten der Stadt New York musikalische Impulse. Seine beiden in Breslau geborenen Söhne Frank Heino und Walter Johannes folgten dem väterlichen Vorbild. Der international anerkannte Dirigent Otto Klemperer aus Breslau (1885–1973) emigrierte 1933 nach Amerika, ebenso wie Moritz Moszkowski (1854–1925), Richard Mohaupt (1904–57) und andere jüdische Musiker. Im späten 19. Jh. machte sich der Einfluss Berlins in der Provinz bemerkbar, nachdem Wien als einstiges Mekka der Musik seinen Glanz eingebüßt hatte. Julius Stern gründete 1853 in Berlin das „Sternsche Konservatorium“, das lange Zeit das „schlesische“ genannt wurde und internationales Ansehen genoss. Vor 1900 wurde die Sogwirkung Berlins noch ausgeprägter. Da Breslau seit 1880 nur ein Konservatorium besaß, mussten nahezu alle schlesischen Musiker für einige Zeit an der Berliner Hsch. studieren. Mehr als Theoretiker denn als Komponist wurde der Breslauer Salomon Jadassohn (1831–1902) am Leipziger Konservatorium in Europa geschätzt. Der Bruckner-Schüler Paul Caro (1859–1914) schrieb in Breslau Opern, Symphonien, symphonische Dichtungen und 30 Streichquartette. Der Oberschlesier Heinrich Schulz-Beuthen (1838–1915) wirkte als Komponist von Symphonien und Opern viele Jahre in Zürich/CH, bis er sich in Dresden/D niederließ.
Überhaupt begann Oberschlesien nach dem industriellen Aufschwung mit seinem Bevölkerungswachstum und immer größer werdenden Städten wie Gleiwitz (Gliwice/PL), Beuthen (Bytom/PL) und Kattowitz (Katowice/PL) eine wichtige Rolle im schlesischen Musikleben zu spielen. Es besaß eine eigene Oper, seit 1883 den Meisterschen Gesangverein, den nach dem Ersten Weltkrieg Fritz Lubrich zu beachtlicher Höhe führte, seit 1910 das Ciepliksche Konservatorium sowie ein aufgeschlossenes musikalisches Laientum. Es stellte im 20. Jh. zahlreiche anerkannte Komponisten wie Arnold Mendelssohn (1855–1938), Richard Wetz (1875–1935), Günter Bialas (1907–95) u. a.
Literatur
(Chronologisch:) Catalogus abbatum Saganensium in Scriptores rerum Silesiacarum 1 (1835), 194, 374; H. E. Guckel, Katholische Kirchenmusik in Sch. 1912; G. Jentsch, Musikgesch. der Stadt Breslau, Diss. Breslau 1919; F. Feldmann, Der Codex Mf. 2016 des musikalischen Instituts bei der Univ. Breslau, 2 Bde. 1932; F. Feldmann, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Sch. 1938, 21973; J. Herrmann, Klingendes Sch. Musikkultur vom Mittelalter bis zum Barock 1938; H. Schieron, Oberschlesische Komponisten 1941; J. Herrmann, Sch.s Stellung innerhalb der dt. Musikkultur 1953; A. Kellner in Anzeiger der phil.-hist. Kl. der ÖAW 1957; L. Hoffmann-Erbrecht, Thomas Stoltzer 1964; G. Kluß, Beuthener Komponisten 1966; E. Peter, ten Gesch. des oberschlesischen Landestheaters und Landesorchesters in Beuthen/Oberschlesien 1972; L. Hoffmann Erbrecht in Mf 27 (1974); F. Feldmann, Die schlesische Kirchenmusik im Wandel der Zeiten 1975; H. Unverricht in Die musikalischen Wechselbeziehungen Sch.-Österreich 1977; R. Walter in G. Pankalla/G. Speer (Hg.), Musik in Sch. im Zeichen der Romantik 1981; L. Hoffmann Erbrecht, Musikgesch. Schlesiens 1986; R. Walter in Oberschlesisches Jb. 7 (1991); Kultura musyczna Dolnego Śląska przeszlość i dzień dzisiejszy. Studia i rozprawy [Musikkultur Niederschlesiens in Vergangenheit u. Gegenwart. Studien u. Erörterungen] 1991; J. Bauman-Szulakowska, Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922–1939. Próba Syntezy [Die ponische Musikkultur in Oberschlesien und dem Teschener Sch. in den Jahren 1922–1939. Versuch einer Synthese] 1994; SchlMl 2001; R. Flotzinger in H. Loos/K.-P. Koch (Hg.), [Kgr.-Ber.] Musikgesch. zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Chemnitz 1999, 2002; A. Brinzing in M. Jabłonski/J. Stęszewski (Hg.), Interdisciplinary Studies in Musicology 4 (2004).
(Chronologisch:) Catalogus abbatum Saganensium in Scriptores rerum Silesiacarum 1 (1835), 194, 374; H. E. Guckel, Katholische Kirchenmusik in Sch. 1912; G. Jentsch, Musikgesch. der Stadt Breslau, Diss. Breslau 1919; F. Feldmann, Der Codex Mf. 2016 des musikalischen Instituts bei der Univ. Breslau, 2 Bde. 1932; F. Feldmann, Musik und Musikpflege im mittelalterlichen Sch. 1938, 21973; J. Herrmann, Klingendes Sch. Musikkultur vom Mittelalter bis zum Barock 1938; H. Schieron, Oberschlesische Komponisten 1941; J. Herrmann, Sch.s Stellung innerhalb der dt. Musikkultur 1953; A. Kellner in Anzeiger der phil.-hist. Kl. der ÖAW 1957; L. Hoffmann-Erbrecht, Thomas Stoltzer 1964; G. Kluß, Beuthener Komponisten 1966; E. Peter, ten Gesch. des oberschlesischen Landestheaters und Landesorchesters in Beuthen/Oberschlesien 1972; L. Hoffmann Erbrecht in Mf 27 (1974); F. Feldmann, Die schlesische Kirchenmusik im Wandel der Zeiten 1975; H. Unverricht in Die musikalischen Wechselbeziehungen Sch.-Österreich 1977; R. Walter in G. Pankalla/G. Speer (Hg.), Musik in Sch. im Zeichen der Romantik 1981; L. Hoffmann Erbrecht, Musikgesch. Schlesiens 1986; R. Walter in Oberschlesisches Jb. 7 (1991); Kultura musyczna Dolnego Śląska przeszlość i dzień dzisiejszy. Studia i rozprawy [Musikkultur Niederschlesiens in Vergangenheit u. Gegenwart. Studien u. Erörterungen] 1991; J. Bauman-Szulakowska, Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922–1939. Próba Syntezy [Die ponische Musikkultur in Oberschlesien und dem Teschener Sch. in den Jahren 1922–1939. Versuch einer Synthese] 1994; SchlMl 2001; R. Flotzinger in H. Loos/K.-P. Koch (Hg.), [Kgr.-Ber.] Musikgesch. zwischen Ost- und Westeuropa. Kirchenmusik – geistliche Musik – religiöse Musik. Chemnitz 1999, 2002; A. Brinzing in M. Jabłonski/J. Stęszewski (Hg.), Interdisciplinary Studies in Musicology 4 (2004).
Autor*innen
Peter Urbanitsch
Lothar Hoffmann-Erbrecht
Rudolf Flotzinger
Lothar Hoffmann-Erbrecht
Rudolf Flotzinger
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Peter Urbanitsch/Lothar Hoffmann-Erbrecht/Rudolf Flotzinger,
Art. „Schlesien‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e0f1
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.