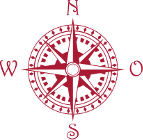Ungarn
(deutsch für ungarisch Magyarország)
Im Westen an Österreich grenzender Staat, zurückgehend auf ein mittelalterliches Königreich an der mittleren Donau; mit Österreich 1526–1918 durch das Herrscherhaus (Habsburger) verbunden (ab 1867 nach dem sog. Ausgleich Doppelmonarchie); 1918 selbständiger Staat (zunächst als Republik, ab 1920 nominell wieder Monarchie), jedoch gemäß Vertrag von Trianon/F (1920) Gebietsabgaben an Jugoslawien (Kroatien), Slowakei, Rumänien (Siebenbürgen) und auch Österreich (Burgenland); ab 1938 enge Verbindungen mit dem nationalsozialistischen Deutschland, 1946 Wiedererrichtung als („2.“) Republik, 1947 Wiederherstellung der Grenzen von 1938, 1948 Bündnisvertrag mit der UdSSR, 1949 Umwandlung in eine kommunistische „Volksrepublik“, 1955 Beitritt zu den Vereinten Nationen, 1989 Austritt aus dem Warschauer Pakt und Demokratisierung, seit 2004 Mitglied der Europäischen Union.Die folgende Darstellung versucht, historische Abläufe nachzuzeichnen und muss daher, mit Ausnahme der kroatischen, auch entsprechende Gebiete von heute selbständigen (Slowakei) bzw. in angrenzenden Staaten (Rumänien) z. T. miteinschließen.
Das historische U. wurde v. a. durch die Krönung von Stephan I. (1000) und die Annahme des römischen Katholizismus zu einem einheitlichen kulturellen Raum. Da dies noch vor dem großen Schisma geschah, brachte es nicht zwangsläufig den Abbruch aller Beziehungen der Magyaren zur Ostkirche mit sich. Bis etwa 1300 erneuerte das Haus der Arpaden mehrfach seine dynastischen Verbindungen zur byzantinischen Kaiserfamilie der Paläologen. Über die politische hinaus sollte jedoch auch die kulturelle, speziell liturgische Zukunft der damaligen Bevölkerung im Karpatenbecken die westliche Ausrichtung des Christentums bestimmen. Obwohl sich Stephan die Krone von Papst Silvester II. erbeten hatte, um einen Vasallenstatus im Römischen Reich zu vermeiden, verlief die Hauptrichtung der politisch-kulturellen Integration des neuen Königtums in das nach-karolingische Europa über das heutige Österreich und Bayern. Bereits seit der Staatsbildung unterhielt U. enge Beziehungen zu Venedig, und ab 1102, als Kroatien für 800 Jahre der Stephanskrone anheimfiel, erstreckte sich der kulturelle Raum, der den u.ischen Königen huldigte, bis Dalmatien. Aus diesen beiden Richtungen kamen Liturgie und Gesang der Westkirche (Choral) nach U. Mit der unter Stephan erfolgten Errichtung der u.ischen Diözesen unter dem Erzbistum Gran (ung. Esztergom, lat. Strigonium) sowie durch großzügige Schenkungen des Königshauses an die monastischen Orden entstand ein das ganze Land überziehendes Netz von Pflegestätten. Wie überall in der vortridentinischen Kirche (Trienter Konzil) bildeten sich auch in U. lokale Varianten der katholischen Liturgie aus. Nach dem Muster der Kathedrale wurden an Kapitelschulen, in bescheidenerem Rahmen auch an Pfarrkirchen Chöre organisiert, durch die der liturgische Gesang praktiziert und auch die Theorie der musica im westlichen Sinn (d. h. als Teil des allgemeinen Wissens, in lateinischer Sprache und Schriftlichkeit) unterrichtet. Den eigentlichen Inhalt dieser Studien vermitteln allerdings nur wenige und relativ späte Quellen, z. B. schulische Aufzeichnungen des späteren Graner Erzb.s László Szalkai (1489/90). Über die liturgische Gesangspraxis informieren z. T. gedruckte Ordinarienbücher (z. B. aus Erlau [Eger/H]). Wie Gesangbücher aus städtischem und dörflichem Milieu aus dem 16./17. Jh. belegen, konnten nicht unbedeutende Fertigkeiten im Lesen und Schreiben der musikalischen Notation bis Ende des Mittelalters selbst an Schulen kleinerer Pfarrkirchen erlernt werden. Allerdings mochte die Schrift bei Import und Verbreitung des liturgischen Gesanges in der ersten Phase der Christianisierung im 11./12. Jh. vorerst nur indirekt eine Rolle gespielt haben. Die auf u.ischem Gebiet im 11. Jh. einsetzende Notation verwendet unterschiedliche Dialekte der deutschen Neumenschrift, so z. B. im sog. Codex Albensis (UB Graz, 211; 1. Drittel des 12. Jh.s). Dieser erste vollständig überlieferte notierte Codex u.ischen Ursprungs wird neuerdings nicht mehr mit Stuhlweißenburg (Székesfehérvár/H, Alba regia), sondern Karlsburg (Gyulafehérvár/H, Alba Iulia/RO), dem Sitz der siebenbürgischen Diözese in Verbindung gebracht. Neumen fanden noch bis ins 13. Jh. sporadische Verwendung (v. a. an der Peripherie), obwohl die Linienschrift bereits im Laufe des 12. Jh.s rezipiert wurde. Der ausgereifte Schriftstil der erstmals im Pray-Codex (H-Bn Mny 1) greifbaren, gleichzeitig mit dem noch mit diastematischen Neumen notierten Haupttext (1192–95) eingetragenen Liniennotation scheint auf eine frühere Einführung (etwa Mitte 12. Jh.) schließen zu lassen. In den u.ischen Skriptorien wurde eine sog. u.ische Notation ausgebildet, die auch als Mittel der Verbreitung des für das ganze Land bindend angesehenen Graner Ritus dienen sollte. Diese Schrift orientierte sich, im Gegensatz zu den Neumen sowie der politischen Orientierung der Arpaden im 13. Jh. und entsprechend der Anjou bzw. Luxemburger im 14./15. Jh., an französischen und italienischen Modellen. Aus den ersten drei Jh.en musikalischer Notation auf u.ischem Boden sind Quellen nur vereinzelt erhalten geblieben. Für das 14./15. Jh. erlaubt die reichere Quellenlage die Identifizierung von zwei Hauptrichtungen der Überlieferung: Die Quellen der Graner Erzdiözese und die Codices des Paulinerordens stellen eine zentrale u.ische liturgische Tradition dar, welche wahrscheinlich gleichzeitig mit der Schrift als bewusste Schöpfung entstand. Daraufhin hat die Erzdiözese Kollotschau (Kalocsa/H) innerhalb des einheitlichen Liturgierahmens ihren eigenen Ritus herausgebildet. Soweit feststellbar, bildeten sich in den anderen Diözesen nur lokale Varianten dieser beiden Hauptriten aus, welche bis Mitte des 17. Jh.s weiterlebten. Während die monastischen bzw. Predigerorden mit Ausnahme der Pauliner den diatonischen Dialekt bewahrten, folgte das gregorianische Melodienrepertoire der Säkularkirche dem sog. germanischen Choraldialekt, dessen Pentatonik auch in für beide u.ische Riten charakteristischen Melodievarianten vorherrscht. Lokal entstandene Melodien können v. a. in den Reimoffizien bzw. in den Allelujagesängen der u.ischen Heiligen Stephan, Emmerich und Ladislaus vermutet bzw. identifiziert werden. Am spätmittelalterlichen Trend der Ordinarienkomposition nahm auch U. regen Anteil: etwa ein Fünftel der Kyrie-Melodien sind nur aus u.ischen Quellen bekannt. Unter den 200 Sequenzen in u.ischen Quellen sind über ein Zehntel Unika.
Eine bescheidene Anzahl von Quellen aus dem späten 15. und 16. Jh. lässt Rückschlüsse auf eine wohl nicht sehr verbreitete usuelle Polyphonie in Lesungen, Passionsrezitation sowie Tropen zu. Zwei Gruppen von Fragmenten aus Kaschau (ung. Kassa, Košice/SK) aus dem 15. Jh. enthalten Bruchstücke von Gesängen für höhere Feste im Kantional- und Motettenstil der Ars nova (H-Bn clmae 534, SK-BRu Inc.318-I, BRmp Inc.33). Auf einem der sog. Fragmente aus der Zeit König Sigismunds befindet sich die Aufzeichnung des Textes zum Osterlied Christ ist entstanden (!) in vier Sprachen: u.isch, deutsch, polnisch und tschechisch, wohl gemäß jenen Sprachen, die im Spätmittelalter in Nord-U. gesprochen bzw. geschrieben wurden. U.isch-sprachige religiöse Lieder mit Melodien sind aus dem frühen 16. Jh. bekannt.
Das umfangreichste Erbe u.ischer Musik hinterließ das Mittelalter jedoch nicht in schriftlicher Form, sondern in der Volksmusik, sodass Zoltán Kodálys (1882–1967) Ausspruch, die Denkmäler der u.ischen Musikgeschichte seien in der Volksmusik zu suchen, in diesem Sinne völlig zutrifft. Obwohl die Auswertung von mündlich überlieferten und nachträglich gesammelten Traditionen (Volksliedsammlung) für historische Beweisführung im Allgemeinen als prekär bewertet wird, lässt sich die mittelalterliche Schicht der u.ischen Volksmusik sowohl funktional als auch stilistisch einwandfrei identifizieren: sowohl Brauchtumslieder zu bestimmten Festtagen des Kirchenjahres als auch europäische Spiellieder, Balladen und Tanzmusik sind in der u.ischen Volksmusik erst nach der Ansiedlung im Karpatenbecken und als Folge der Integration der Magyaren in ihr neues ethnisches und kulturelles Umfeld aufgetreten. Die im Mittelalter angeeigneten Melodietypen unterscheiden sich von den archaischen, welche als Erbe der u.ischen Vorgeschichte weiterlebten und dabei bedeutenden Veränderungen unterworfen waren. So wird der isosyllabische Strophenbau des pentatonischen Volksliedes „alten Stils“ und sein Typenreichtum wohl zu Recht auf mittelalterliche und frühneuzeitliche Anregungen des europäischen Umfeldes zurückgeführt.
Kodálys Behauptung, das Historische, das in oraler Tradition als Denkmal erhalten blieb, sei einst Gemeingut der ganzen Nation (also auch das der Führungsschichten) gewesen, kann nicht bewiesen werden. Die Führungsschicht war im Lauf des Mittelalters und auch später stets zuerst von kulturellen Moden betroffen, welche Gäste in der Begleitung von Königinnen und nicht-u.ischen Landesherren aus dem Westen oder aus Byzanz mitbrachten, als Statussymbole galten und Nachahmung fanden. In der Begleitung der Kreuzfahrer hielten sich im 11. Jh. die Trobadors Peire Vidal und Gaucelm Faidit am u.ischen Königshofe auf. Hinsichtlich der Lebensweise könnte sich Kodálys These jedoch sehr wohl bewahrheiten: die Musik der Führungsschichten vor dem 15. Jh. dürfte im Bereich der mündlich bzw. spielerisch tradierten Kultur angesiedelt gewesen sein. Chroniken berichten von epischen Gesängen, die von Mitgliedern der Aristokratie selber nach Art der asiatischen Heldengesänge gesungen wurden. Zahlreiche Erwähnungen von Spielmännern und Musikern in mittelalterlichen Urkunden zeugen von einer weit verbreiteten usuellen instrumentalen Musikkultur. Die erste auf u.isch aufgezeichnete Dichtung, eine Übersetzung des Planctus Mariae aus dem 13. Jh., ist ohne Notation überliefert. Von einer autochthonen, einstimmig oder gar mehrstimmig komponierten weltlichen Musik fehlt im mittelalterlichen U. jede Spur. Das ist umso verständlicher, als auch die Voraussetzung dafür, eine weltliche Poesie in der Volkssprache, fehlte.
Doch ist ab 1300, als nach dem Aussterben der Arpaden der neapolitanische Zweig der Anjou, nach 1380 Luxemburger, Habsburger und Jagellonen auf den u.ischen Thron kamen, mit der Einbindung des Hofs und Hochadels in die überregionale europäische höfische Kultur zu rechnen. Besonders aktiv erwies sich der Hof des Kg.s Matthias Corvinus (1458–90), der den Ausbau einer überregionalen ost-zentraleuropäischen Macht zwischen dem Römischen Reich und dem türkischen Imperium, das die Südgrenze Ungarns seit einem Jh. bedrohte, anstrebte. Er wollte eine Hofhaltung nach burgundisch-italienischem Muster aufbauen, die ihm auch von seiner zweiten Frau, der Neapolitanerin Beatrix von Aragon, vermittelt wurde: neben großen Bauwerken, Heranziehung von italienischen und Förderung von einheimischen Humanisten (wie des ersten, lateinisch dichtenden u.ischen Poeten Janus Pannonius), Errichtung einer königlichen Bibliothek mit Prachthandschriften (z. B. das Corvinus-Graduale, H-Bn Clmae 424) auch durch eine repräsentative Kapelle. Seine Nachfolger, die Jagellonen-Könige, besonders die Königinnen Anna von Candale und Maria von Habsburg setzten diese Bestrebungen von Matthias fort.
Nach der Schlacht bei Mohács (1526), in der Kg. Ludwig II. selbst den Tod fand sowie der 1541 erfolgten dauerhaften Besetzung des Landesinneren einschließlich Buda durch die Osmanen begann eine neue Phase in der u.ischen Geschichte: Das Land wurde dreigeteilt in das „königliche U.“ (ein schmaler Landstreifen im Westen und Norden), dessen Könige aus dem Hause Habsburg stammten; im Osten entstanden als türkischer Vasallenstaat das von frei gewählten Fürsten aus u.ischen Adelsgeschlechtern regierte Großfürstentum Siebenbürgen und die bis zur Mitte des 17. Jh.s ständig wachsende türkische Besatzungszone, deren Janitscharenmusik (Türkische Musik) bis ins 18. Jh. das Ohr des Westens ebenso faszinierte wie erschreckte und dessen Bild von U. als „Reich des Ostens“ nachhaltig prägte. Parallel zur geopolitischen Aufteilung verlief eine konfessionelle Zwei- bzw. Dreiteilung: nachdem im 16. Jh. die Lutherische bzw. Calvinische Reformation in der Bevölkerung Fuß gefasst hatte, wechselten bis Mitte des 17. Jh.s etwa 3/4 der Bevölkerung zu diesen zwei Konfessionen. Die Gegenreformation nahm ihren Ausgang vom Habsburgischen Landesteil und wurde nach der Rückeroberung des Landesinneren und der Rückkehr Siebenbürgens zur Stephanskrone mit krasser Intoleranz vorangetrieben. So bedrückend die Aufteilung des Königreiches, die osmanische Ausbeutung und die ständigen Kriege auch waren, zog U. aus seiner Grenzlage jedoch auch Vorteile. Das von den Habsburgern unabhängige Siebenbürgen konnte unter der konfessionell neutralen Schirmherrschaft der Hohen Pforte kulturell wie konfessionell ein Gegengewicht zu den forcierten Rekatholisierungs- und Eindeutschungsbestrebungen des Habsburgerhofes bilden und eine geistig-kulturelle u.ische Selbständigkeit bewahren bzw. erst entwickeln. Die regen kulturellen Beziehungen des Fürstentums und Kroatiens, dessen Adel in den Türkenkriegen eine Führungsrolle übernommen hatte, zu Italien führten zur Übernahme von poetischen Formen und Gattungen der Renaissance und des Barock, sodass Volkssprachigkeit nicht nur durch Bibelübersetzungen und geistliche Lieder aller Konfessionen, sondern auch in höfischen Formen heimisch wurde. Die spannungsgeladene politische Situation wurde erstmals in große u.ische Literatur umgesetzt, v. a. von Dichtern wie Bálint Balassi im 16. und Miklós Zrinyi (kroat. Zrinsky) im 17. Jh., zwei adelige Dichter, welche selbst bedeutende Rollen im politischen Geschehen spielten. Die gesprochene bzw. geschriebene u.ische Sprache erhielt gewaltigen Aufschwung durch die protestanischen und katholischen Bibelübersetzungen im 16. und die Streitschriften beider großen Konfessionen im 17. Jh., unter deren Verfassern sich Sprachkünstler wie Péter Kardinal Pázmány befanden. Die politischen Ereignisse zeitigten eine neue Welle der Volksdichtung. Beide Konfessionen bildeten ihr modernes Unterrichtswesen aus und die Schriftlichkeit verbreitete sich auch in der Musik. Vieles, was das moderne u.ische Selbstgefühl bestimmen sollte, verdankt seine Entstehung den kataklysmischen Jh.en von Mohács bis zur 1711 erfolgten Niederschlagung des Rákóczi-Aufstandes durch die Habsburger.
Für eine auch nur entfernt an die kontinentale Elite heranreichende musikalische Entwicklung waren die Bedingungen in U. vor 1700 denkbar schlecht. Da bei der u.ischen Bevölkerung die helvetische Richtung der Reformation überhand nahm, blieb bei ihnen kunstmäßige liturgische und Andachtsmusik ein unbebautes Feld. Die Städte der Siebenbürger Sachsen und in der Zips (ung. Szepesség, Spišska/SK) blieben lutherisch-evangelisch und bezogen ihr mehrstimmiges Repertoire vorwiegend aus Deutschland, wie z. B. die Sammlung von Musikdrucken und handschriftlichen Kopien aus der Aegidiuskirche von Bartfeld, Leutschau (ung. Lőcse, Levoča/SK) aus dem 16./17. Jh. zeigt (heute in der u.ischen Nationalbibliothek). Der Einführung moderner Bühnen- und Kirchenmusikgattungen (Oper, Oratorium) entzog die exterritoriale Lage des Königshofes die primäre Existenzgrundlage: Repräsentationsbedarf des absoluten Herrschers. Einzig Pressburg (ung. Pozsony), bis Ende des 18. Jh.s Haupt- und Krönungsstadt der Habsburger als u.ische Könige, profitierte von den gelegentlich dorthin verlegten Haupt- und Staatsaktionen des Wiener Hofs, bei denen Theater und Musik eine bekannt große Rolle spielten. Der alte Adel des königlichen U., in anti-osmanische Kämpfe und anti-habsburgische Verschwörungen verwickelt, konnte bis Ende des 17. Jh.s nicht an Hofhaltungen größeren Stils denken. Erst im Laufe des 18. Jh.s baute ein neuer, Habsburg-treuer Hochadel seine höfischen Repräsentanzen aus, dann aber zuweilen mit ostentativ orientalisch anmutender Pracht; dem nüchternen Johann Wolfgang v. Goethe blieb „das Esterházysche Feenreich“, das er in Frankfurt am Main/D bei der Krönung von Franz Stephan v. Lothringen zum römischen Kaiser bestaunte, lange genug in Erinnerung, um noch in Dichtung und Wahrheit Eingang zu finden. Die beiden erzbischöflichen Sitze Gran und Kollotschau blieben im türkisch besetzten Landesteil; der Primas der katholischen Kirche verlegte 1543 seine Residenz nach Tyrnau (ung. Nagyszombat, Trnava/SK), hielt aber vorwiegend in Pressburg Hof. Aus der Kapitelschule in Tyrnau schuf Péter Pázmány 1635 die erste und für lange Zeit einzige u.ische Univ., die erst 1773 nach Pest (Budapest) übersiedeln sollte. Der eigentliche u.ische Fürstenhof residierte in Karlsburg. Zur Festigung einer eingewurzelten musikalischen Praxis konnte es hier allerdings nicht kommen, weil zum einen Land und Hof ständig verheerenden Einbrüchen von Tataren, Kosaken, Türken und deren Moldauischen Vasallen ausgesetzt war, und zum anderen die Regierungsform des Wahlfürstentums, wohl aus Berechnung der Osmanen, für fast ununterbrochene innere Zwistigkeiten und bürgerkriegsähnliche Zustände sorgte, sodass keine Dynastie eine dauerhafte Hausmacht aufbauen konnte.
Die Musik U.s zerfiel im 16./17. Jh. in drei Teile, die ungefähr der machtpolitischen Dreiteilung entsprachen, aber auch unterschiedliche wirtschaftlich-kulturelle Strukturen der Landesteile widerspiegeln, welche sich bereits im Mittelalter entwickelt hatten. Mit Ausnahme von Buda befanden sich die blühenden königlichen Freistädte an den westlich-nördlichen Randstreifen des Landes und in Siebenbürgen, also auf nichtbesetztem Gebiet: Ödenburg (ung. Sopron), Pressburg, Tyrnau, die reichen Bergbaustädte Neusohl (ung. Besztercebánya, Banská Bystrica/SK), Kremnitz (ung. Körmöcbánya, Kremnica/SK), Schemnitz (ung. Selmecbánya, Banká Štiavnica/SK) sowie Bartfeld (ung. Bártfa, Bardejov/SK) und Kaschau; die Siebenbürger „Sachsenstädte“ Hermannstadt (ung. Nagyszeben, Sibiu/RO), Kronstadt (ung. Brassó, Braşov/RO), Schässburg (ung. Segesvár, Sighişoara/RO) sowie das überwiegend u.ische Klausenburg (ung. Kolozsvár, Cluj-Napoca/RO) und der Fürstensitz Karlsburg in Siebenbürgen. Im türkisch besetzen Gebiet bestanden nur kleinere Städte und Marktflecken ohne nennenswerte städtische musikalische Strukturen. Der erzbischöfliche Sitz Kollotschau sowie die Bischofssitze Weißbrunn (Veszprém/H), Erlau, Großwardein (ung. Nagyvárad, Oradea/RO) wurden aufgegeben, nur Raab (Győr/H) blieb verschont. Der öffentliche und private Musikbedarf in den königlichen Freistädten mit mehrheitlich deutscher oder gemischter Bevölkerung wurde hauptsächlich von den städtischen Turmmusikern (Thurner) befriedigt, die ihre Privilegien gegen durchziehende oder einheimische nichtorganisierte Musiker stets eifersüchtig, aber nicht immer erfolgreich zu verteidigen suchten.
Das geschichtliche und kulturelle, damit auch sprachliche und musikalische Selbstbewusstsein (Identität) der u.ischen (d. i. nicht nur der magyarischen) Bevölkerung wurde durch zwei historische Ereignisse von Grund-erschütternder Tragweite geweckt und wachgehalten, welche, eigentlich voneinander unabhängig, aber zusammen wirksam, der mittelalterlichen Kultur ein Ende setzten: die Türkenkriege und die Reformation. Mit beiden Ereignissen verbanden sich zeitlich und kausal unentflechtbar verwobene Entwicklungen wie der Verlust der staatlichen Integrität sowohl gegenüber den Türken als auch den Habsburgern sowie die Erneuerung des Katholizismus im Zeichen der Gegenreformation. Die Reformation war wie ein Steppenbrand verlaufen, sodass bis Ende des 17. Jh.s etwa 3/4 der Bevölkerung entweder zum lutherischen (v. a. die deutsche und slowakische) oder helvetischen Bekenntnis (v. a. die u.ische Bevölkerung) wechselte. Wie in Deutschland begegnete die Lutherisch-evangelische Kirche der Kunstmusik mit besonderem Wohlwollen. Größere, meist fragmentarische Musikalienbestände wie der von Bartfeld (um 1600) und die der Evangelischen Kirche in Ödenburg (v. a. aus dem 18. Jh.) weisen auf Beziehungen zu Musikzentren in Böhmen und Deutschland hin. Außer Musik importierten die Städte auch Musiker für die Ausschmückung der Liturgie. A. Rauch aus Pottendorf/NÖ und J. Wohlmuth aus Rust/Bl in Sopron, Zacharias Zarewutius (1605?–67) in Bartfeld bereicherten das Repertoire mit eigenen Kompositionen. Allerdings bleibt in vielen Fällen offen, ob die in u.ischen Sammlungen überlieferten Werke von ihnen bereits mitgebracht oder eigens für die hiesigen Kirchen komponiert wurden. Nach 1673 verloren die evangelischen Gemeinden unter dem Druck der Gegenreformation ihre Kirchen und die in den Städten zahlenmäßig abnehmenden mussten, mit Ausnahme von Sopron und den sächsischen Städten in Siebenbürgen, auf artifizielle Musik größtenteils verzichten. Die katholische Kirchenmusik hingegen nahm mit der Gegenreformation einen Aufschwung und schlug auch eine neue Richtung ein. Es ist wohl nicht nur dem Verlust von Quellen zuzuschreiben, dass es in U. aus der Zeit vor 1600 nur sporadisch Hinweise auf regelmäßige Pflege polyphoner liturgischer Musik an Kathedralen und Kapitelkirchen gibt, obwohl wir mehrstimmige Messordinarien und Proprien-Motetten am Hofe von Matthias Corvinus und Beatrix von Aragon bzw. ihren Jagellonischen Nachfolgern annehmen dürfen. Erst der heute in Pressburg aufbewahrte, wahrscheinlich in Prag geschriebene, von Anna Hannsen-Schuman der Pressburger Pfarr- und Kapitelkirche gewidmete Codex (SK-BRsa, Knauz Nr. 11), die früheste (1571) erhalten gebliebene größere polyphone Handschrift auf dem Gebiet des ehemaligen U., weist auf eine dauerhafte Pflege artifizieller Polyphonie in der Liturgie hin. Dem Fehlen einer musikalischen Ausbildungstradition und dem schwachen Kirchenmusikpersonal ist zuzuschreiben, dass die zu Beginn des 17. Jh.s aufkommende italienische konzertante Stilrichtung in der katholischen Kirchenmusik nur in ihrer von Lodovico Viadana geprägten Kleinform übernommen werden konnte, immerhin aber mit dem Organo Missale des Franziskanermönches János Kájoni 1667 auch in der lokalen Komposition Nachahmung fand. Der Prachtdruck der Harmonia coelestis, der 1711 unter dem Namen des Palatins P. Esterházy erschienen ist (dessen Autorschaft wird neuerdings angezweifelt), rechnet mit einem größeren Apparat, stellt aber keine eigentlich liturgische Musik dar, sondern gehört mit ihren anonymen Instrumentalpartien und liedhaften Sätzen (z. T. nach bekannten Kirchenliedern) eher zum kleinen geistlichen Konzert.
Es ist nicht feststellbar, ob sich die kirchliche Volksgesangspraxis nach 1500 tatsächlich so sehr von der mittelalterlichen unterschied, wie es die Quellen nahelegen. Jedenfalls hatten sich im u.ischen Mittelalter keine mit Lauden, Geißler- oder Hussitenliedern vergleichbaren Volksgesangsrepertoires ausgebildet. Volkssprachlicher strophischer Kirchengesang verbreitete sich erst mit der Reformation. Das erste Gesangbuch (Kirchengesangbuch) der u.isch-lutherischen Kirche erschien 1536 (Kegyes énekek von István Gálszécsi), das der helvetischen Konfession 1560 und 1574 (Gál Huszár, A keresztyéni gyülekezetben való isteni dicséretek). Der neuen Liturgie entsprechende Melodien des gregorianischen Gesanges wurden bis ins frühe 17. Jh. in u.ischer Übersetzung weiter gesungen und in handschriftlichen Gradualien gesammelt oder gedruckt (z. B. Öreg Gradual, 1636). Die Einführung des Genfer Psalters in die Calvinisch-reformierte Kirche verdrängte allerdings alle anderen Gesangsarten. Nach langem Widerstand führte um die Mitte des 17. Jh.s auch die katholische Kirche das strophische Kirchenlied in der Muttersprache als geeignetes Mittel der Gegenreformation ein (Cantus Catholici, 1651). Als Folge der Rekatholisierung der Massen wurden auch protestantische Lieder ins katholische Volksgesangsrepertoire übernommen. In vielen Kirchen geriet der gregorianische Gesang aufgrund einer Verordnung der Synode von Tyrnau (1629) zur Einführung des tridentinisch-römischen Ritus und des dadurch verursachten Traditionsbruchs außer Gebrauch.
Instrumentalmusik, von der früher nur sporadisch etwas im Blickfeld von Notation und Komposition erschienen war, wurde vom 16. Jh. an breiter auch schriftlich rezipiert und in neuen Formen der artifiziellen Musik wie Suite, sonata bzw. concerto da camera gepflegt. Unter den Tanztypen aus dem östlichen Europa erschienen auch u.ische Tänze wie z. B. die Ungaresca (Giorgio Mainerio 1576, Jakob Paix 1583) und der Passamezzo ungaro in gedruckten und handschriftlichen Tanzsammlungen für Laute, Klavier und Ensembles in Italien, Deutschland und den Niederlanden. Aus dem 17. Jh. sind Orgeltabulaturen (Tabulatur) mit weltlichem und geistlichem Inhalt überliefert: aus Leutschau, die Handschrift des János Kájoni (Csíkszereda, Miercurea Ciuc/RO, Hargita Megyei Múzem/Muzeul Judeţean Harghita Cod. 35) und der sog. Kodex Vietorisz (H-Ba K. 88). Der alte u.ische Tanz des 16./17. Jh.s, der vom Heyduckentanz nicht klar zu unterscheiden ist, machte vorerst keine Polacca (Polka) vergleichbare Karriere in der Kunstmusik.
Es wäre nicht ganz unbegründet, U. (wie Böhmen) in der absolutistischen Epoche zwischen der Niederschlagung der Revolten unter Imre Thököly (1684) und Ferenc Rákóczi (1703) bzw. der französischen Revolution (1789) als österreichische Kolonie anzusehen: es gab keinen königlichen Hof, damit keine Pflegestätte erster Größenordnung für die musikalischen und musikdramatischen Großformen, für welche das 18. Jh. sonst ein so günstiges Umfeld gewährte. Mehr noch: die vollkommen Habsburg-treu gewordene u.ische Aristokratie (Adel) – z. T. Aufsteiger wie die Esterházy, Grassalkovics, Keglevich, Pálffy und Batthyány sowie sog. indigene („eingeadelte“ deutsche, böhmische, ja sogar italienische Familien wie die Pallavicini) – zog es naturgemäß an den Hof in Wien; in U. hielten sie sich (außer natürlich auf ihren Schlössern) zeitweise höchstens in Pressburg auf, wo auch die adelige Landesversammlung (Landtag) tagte. Um auch den mittleren Adel an das Herrscherhaus zu binden, führte K.in Maria Theresia die Institution der U.ischen Leibgarde in Wien ein. Im 18. Jh. wechselte die Aristokratie, wenn sie nicht ohnehin deutschsprachig war, in ihren Hofhaltungen vom Gebrauch der u.ischen zur deutschen Sprache. Die 1777 eingeführte Volksschulordnung (Ratio educationis) trieb die Deutschsprachigkeit auch in niederen Schichten voran. Aristokratie und Adel im Gubernium Siebenbürgen blieben zwar u.isch, waren aber wirtschaftlich zu schwach, um mit den Magnaten im Königtum U. repräsentativ zu wetteifern. Trotzdem wurde mit Unterstützung transsilvanischer Familien wie den Wesselényi und Teleki die mehrheitlich u.ische Hauptstadt Klausenburg um 1800 zur Wiege des u.ischen Theaters und erhielt 1818 das erste auch sprachlich u.ische Konservatorium. Das bereits seit der Türkenzeit bestehende Prestige Siebenbürgens als eigentlicher Bewahrerin der u.ischen Nationalkultur nahm in der vorromantischen und romantischen Epoche noch zu. (Gerade deshalb sollte seine Abtrennung von 1920 ein kaum zu verschmerzendes Trauma werden.)
Obwohl Volkslied und Kirchenlied weiterhin in den Muttersprachen gesungen wurden und die nationale Tanzmusik bereits um 1730 neuen Auftrieb erhielt, verschwanden in der Folgezeit die semi-folkloristischen Gattungen des 16./17. Jh.s wie der populäre epische „historische Gesang“ und das Kurutzenlied. Infolge demographischer Veränderungen zuungunsten des magyarischen Bevölkerungsanteils und der regen Westbindung unterlag selbst das u.ische Volkslied einer Veränderung und nahm zahlreiche westslawische Einflüsse auf. Diese Umgestaltung ließ für die spätere nationale Sichtweise das 18. Jh. als Epoche der „Nationslosigkeit“ erscheinen (so auch Béla Bartók [1881–1945] in einer musikgeschichtlichen Skizze U.s von 1920). Unter den führenden u.ischen Komponisten und Instrumentalisten des 19. Jh.s entstammten F. Liszt, Mihály Mosonyi (M. Brand), der Komponist und Musikschriftsteller Gábor Mátray (1797–1875; eig. Rothkrepf), der Violinist E. Reményi (eig. Hoffmann), der Geiger und Komponist J. Hubay (eig. Huber) und väterlicherseits auch F. Erkel aus alteingesessenen deutschen Familien. Andere wie die Geiger M. Rózsavölgyi (1789–1848), Dávid Ridley-Kohne (1812–92) und J. Joachim, kamen aus deutschsprachigen jüdischen Familien. Dass jedoch der junge Bartók 1902 in einem Brief an die Mutter die deutschsprachigen Lehrer an der Budapester MAkad. wie H. Koessler (1853–1926), V. v. Herzfeld, Karl Gianicelli (1860–1935) und D. Popper gegen ultranationale Angriffe im Abgeordnetenhaus und in der Presse verteidigte, zeigt, dass er als in der klassischen Tradition erzogener Fachmusiker und aus eigener Erfahrung vom unbestreitbaren Nutzen der österreichisch-deutschen musikalischen Kolonialisierung überzeugt war. Davon, was sich in U. und Siebenbürgen in der Kunstmusik des 18. Jh.s tatsächlich getan hatte, konnte Bartók allerdings, außer vielleicht der Tätigkeit J. Haydns in Eisenstadt (ung. Kismarton, damals zu U. gehörig) kaum eine Ahnung haben. Die Musikgeschichte des 18. Jh.s wurde von u.ischen, slowakischen, siebenbürger-deutschen und kroatischen Wissenschaftlern erst in den letzten Jahrzehnten erforscht und die Ergebnisse sind (2006) zu einem großen Teil noch unveröffentlicht.
Als entscheidendes Moment der Musikalisierung des nunmehr unabhängigen Landesgebietes (das allerdings bis 1848 als Königreich U. und Großfürstentum Siebenbürgen separat regiert wurde) ist, wie im Mittelalter, die Erneuerung der katholischen Kirchenstruktur zu betrachten. Dies geschah im Geiste der Gegenreformation und tangierte somit die protestantische Bevölkerung nicht unmittelbar. Die Kirchenmusik und der Musikunterricht bzw. die musikalisch-dramatische Praxis in den Ordenskirchen und -schulen (insbesondere der Jesuiten und Piaristen) bildeten aber das Fundament auch für die neuartige musikalische Kultur der größeren Städte, in denen die konfessionellen Gegensätze bis Ende des Jh.s langsam abflauten. Somit konnte die neue katholische Kirchenmusik indirekt auch für die protestantische Bevölkerung von kultureller Bedeutung werden, helvetisch-reformierte Städte wie Debrezin (Debrecen/H) zunächst vielleicht ausgenommen. Unter den Bistümern besaß Raab die stärksten Musiktraditionen: wegen seiner westlichen Lage und da es von türkischer Besatzung weitgehend verschont geblieben war. Eigentlich als Neugründung aber kann Großwardein am östlichen Rande der großen u.ischen Tiefebene gelten, wo der musikliebende Bischof Adam Graf Patáchich einige Jahre lang eine leistungsfähige Kapelle mit österreichischen und böhmischen Musikern, darunter M. Haydn und C. Ditters v. Dittersdorf unterhielt. Die Bischofsitze Fünfkirchen (Pécs/H), Neutra (ung. Nyitra, Nitra/SK), Erlau und Temeschburg (ung. Temesvár, Timişoara/RO) verfügten über verhältnismäßig reiche musikalische Ressourcen. Ihr Repertoire entsprach dem allgemeinen süddeutsch-österreichisch-böhmischen, viele Musiker und Regentes chori sowie Musikdrucke kamen aus diesen Gebieten. Nach der Gewohnheit der Zeit begnügten sich die Kapellmeister nicht mit der importierten Kirchenmusik, sondern übten oft eine rege Kompositionstätigkeit aus (insbesondere für Messe und Offizien). In Raab wirkten u. a. J. G. Albrechtsberger und Benedek Istvánffy (1733–78), der erste bedeutende Komponist von Figuralmusik u.ischer Abstammung. Fünfkirchen war ab 1703 bis ins späte 19. Jh. Wirkungsstätte für eine Reihe Wiener und böhmischer Komponisten wie Anton Paumon (B. Paumann), Franz Anton Novotny, F. Krommer, J. G. Lickl und F. S. Hölzl. Pfarrkirchen in den größeren Städten stellten bedeutende Komponisten als Kapellmeister an, wie den Pester Regens chori Josef Bengraf (1745–91), der als einer der Ersten u.ische Tänze in Wien veröffentlichte. Bengraf ist auch als Komponist von Kammermusik hervorgetreten. Da Kirchenmusik zuerst das obligate Kirchentrio, im letzten Drittel des 18. Jh.s dann das Orchester in der klassischen Besetzung heranzog, wurden die Kirchenkapellen auch dort, wo sie nicht neu gegründet werden mussten, reorganisiert und durch eine mancherorts bescheidene, doch stabile instrumentale Gruppe ergänzt. Die Kirchenkapellen bildeten somit die am frühesten institutionalisierte Grundlage auch für die nichtkirchliche konzertante Musikausübung (bürgerliche Musikkultur).
Nach der Konsolidierung der politischen Verhältnisse wurde an den Hofhaltungen der Kirchenfürsten und in den Schlössern und Stadtpalais des Hochadels mit Vorliebe die konzertante Musik gepflegt. Dass die Esterházys J. Haydn als Kapellmeister 30 Jahre lang in ihrem Sold hatten, war kein Anfang, sondern die Krönung ihrer höfischen Musikpflege (J. G. Werner). Parallel mit der Entwicklung der instrumentalen Gattungen in Österreich und der Oper in Italien, nahm in Haydns Schaffen für den Hof und in seiner Tätigkeit als Kapellmeister gegenüber Werners Zeit die Musik für Kammer und nach 1770 die Oper überhand, sodass in den 1780er Jahren am Esterházyschen Hof ähnlich wie in Wien ein musikalisches Programm dargeboten wurde, das das moderne städtische Konzertleben und Opernrepertoire vorwegnahm. Die dauerhafte Blüte der Esterházyschen Musikpflege im 18. Jh. fand eine nur kurzfristige Parallele im Mäzenatentum des Fürsterzb.s Jozef Batthyány in Pressburg in den 1770/80er Jahren. Von der Musikpflege an anderen Residenzen des Hochadels und an den Familiensitzen des mittleren Adels im späten 18. und frühen 19. Jh. zeugen Notensammlungen, Familienarchive und so manche Musikerbiographien wie die von Fr. Schubert (als Klavierlehrer bei den Grafen Esterházy), H. Marschner (1795–1861; 1817–21 in Pressburg bei J. N. v. Zichy-Vásonykeő) und M. Brand-Mosonyi. Einen bedeutenden Schritt in Richtung Verstädterung der Musikpflege machte János Nepomuk Graf Erdődy ebenfalls in Pressburg, indem er zwischen 1785/89 in seinem Stadtpalais regelmäßig Opernaufführungen veranstaltete. Ihre Bedeutung lag im städtischen Ambiente, der Öffnung auch für eine – allerdings sozial begrenzte – städtische Öffentlichkeit sowie der Deutschsprachigkeit. Nach der Auflösung der Erdődy-Oper übersiedelte die dort tätige Truppe von H. Kumpf z. T. nach Buda (Ofen) und gründete im dortigen Festungstheater das erste professionelle ständige deutsche Theater in der nunmehrigen Doppelhauptstadt Budapest. Die Zwillingsstadt Pest am linken Donauufer folgte mit ihrem in der Rotunde der ehemaligen Stadtbefestigung eingerichteten Theater nach. Pest sollte Buda in Bewohnerzahl und kultureller Regsamkeit bald überholen. Ein Zeichen dafür war der Bau des großen klassizistischen Gebäudekomplexes des königlich-städtischen Theaters und der Redoute am Donauufer. Eröffnet wurde das Theater mit Gelegenheitsmusik von L. v. Beethoven (1812). Deutschsprachige Theater mit bedeutendem Anteil von Musik in den allabendlichen Programmen wurden nach Pressburg, Buda und Pest auch in Städten wie Fünfkirchen, Temesvár, Kaschau u. a. errichtet. Das deutsche Theater in Pest war bis 1847, als es durch Brand vernichtet wurde, Teil eines organischen Theatersystems im deutschsprachigen Raum. Das Singspiel- und Opernprogramm richtete sich nach dem Repertoire der Wiener Hofoper und der Vorstadttheater, Wiener Sängergrößen statteten der Bühne regelmäßig Besuche ab. Für manche bedeutende Sänger wie den Tenor J. Erl oder die Mezzosopranistin A. Schebest hatten ihre Engagements in Pest große Bedeutung für ihre Karriere.
Der Versuch der Gründung eines u.ischen Theaters Anfang der 1790er Jahre wollte mit bescheidenen Mitteln dem deutschen Muster folgen. Als erste (auf dem Theaterzettel so genannte) Oper wurde 1793 in einem provisorischen Theater in Buda die Wiener Parodie von Ph. Hafner Evakathel und Prinz Schnudi in u.ischer Bearbeitung unter dem Titel Pikkó hertzeg és Jutka-Perzsi mit der (verlorenen) Musik des Kapellmeisters J. Chudy aufgeführt. Chudy war mit der Pressburger Gesellschaft nach Buda gekommen und pendelte eine Zeit lang zwischen dem deutschen und dem ungarischen Theater. Da in den Städten Buda und Pest mit ihrer überwiegend deutschen Bevölkerung und hochentwickelten deutschen Theater- und Musikkultur die halbdilettantische u.ische Theatergesellschaft kein günstiges Terrain fand, musste sie sich nach kurzer Zeit auf Wanderschaft begeben. Freundliche Aufnahme und das nötige Mäzenatentum fand sie um 1800 in Klausenburg, wo bald das erste ständige u.ische Steintheater eröffnet wurde (1821). Ende der 1810er Jahre formierte sich um die singende Schauspielerin Róza Déry (1793–1872) die erste u.ische Singspielgesellschaft, welche sich neben dem deutschen und französischen Singspielrepertoire bald auch an C. M. v. Weber und G. Rossini wagte. Da die Déry sehr populär war und die neue Opernmode das Publikum faszinierte, verdankte sich die landesweite Festigung des u.ischen Theaters eigentlich dieser Gattung. Auch im ständigen U.ischen Theater zu Pest, 1837 eröffnet und 1840 zum Nationaltheater erhoben, spielte die Oper, nunmehr mit vorwiegend italienisch-romantischem Repertoire, eine entscheidende Rolle, v. a. dank der aus Siebenbürgen gebürtigen, in Pressburg und Wien ausgebildeten ehemaligen Hofopernsängerin R. Schodel und des ersten Kapellmeisters F. Erkel. Das Orchester des neugegründeten Theaters war zwar zahlenmäßig nicht stark, seine aus Wien und Prag stammenden Musiker aber von gutem Niveau. Oper wurde in der u.ischen Hauptstadt abwechselnd mit dem Schauspiel im Nationaltheater gegeben, bis 1884 die königlich-u.ische Oper (seit 1946 Staatsoper) eröffnet wurde.
In dem um 1825 einsetzenden Zeitalter des nationalen Erwachens (sog. Reformzeit) war das magyarische Bildungsbürgertum, das sich für die Erneuerung der Sprache und die Schaffung einer nationalen Literatur einsetzte, vom Vordringen der Oper alles andere als erbaut. Diese Haltung wurde emphatisch von dem Bewusstsein untermalt, dass die Magyaren eine eigene „atavistische“ Musik hatten; es galt, sie vor Neukolonialisierung durch die international-kosmopolitische Oper und die damals schon sog. „klassische“ Musik zu schützen. In der Tat war ab etwa 1730 der u.ische Tanz in handschriftlichen Sammlungen in einer neuen, charakteristischen Form erschienen, welche bei Haydn und anderen Wiener Musikern im letzten Drittel des 18. Jh.s als exotisches Genre all’ongarese bzw. alla zingarese breite Resonanz fand (Zigeunermusik). Die neue u.ische Tanzmusik setzte sich aus Elementen des Bauerntanzes und des Werbetanzes (verbunkos) zusammen; als Bausteine verwendete man auch fragmentarisch überlieferte Momente aus der Zeit des anti-Habsburgischen Widerstandes um 1700 (Kurutzenlieder, Rákóczi-Lied). Aus solchen Motiven wurde 1815 von einem Militärkapellmeister der Rákóczi-Marsch zusammengestellt, der in der romantischen Epoche im In- und Ausland nicht nur als National-, sondern auch Freiheitssymbol popularisiert wurde, v. a. in der überschäumend Berliozschen Orchesterbearbeitung der von Erkel verfertigten Klavierfassung des Marsches. Es ist nicht völlig klar, unter welchen Umständen die Aufführung der u.ischen Tanzmusik in den Städten und den Residenzen des Adels von Zigeunerkapellen übernommen wurde (um Missverständnissen vorzubeugen, sollte man im Zusammenhang mit style hongrois nicht von Roma sprechen); von einer Ausschließlichkeit kann bis ins 19. Jh. nicht die Rede sein. Vielmehr war die Kreation und Ausführung des magyars (so die gebräuchliche zeitgenössische Bezeichnung) eine interethnische Angelegenheit, wie die Zusammensetzung der ersten großen Generation der verbunkos-Komponisten zeigt. Unter ihnen zeichneten sich der notenunkundige brillante Zigeunergeiger J. Bihari, der Böhme Anton Tschermak (1774–1822), der Jude M. Rózsavölgyi-Rosenthal und der ungarische Kleinadelige J. Lavotta (1764–1820) aus. Bereits zwischen 1823/32 sind 15 Hefte der Serie Magyar nóták Veszprém Vármegyéből erschienen, die als erste Zusammenfassung der klassischen verbunkos-Tradition angesehen werden kann. Lavotta, Tschermak und Rózsavölgyi versuchten, aus dem Tanzmusikmaterial größere Instrumentalformen zu schaffen, was möglich schien, da die tradierte Musik selbst unterschiedliche Charaktere aufzuweisen hatte: langsam (auch „hallgató“ genannt, d. h. Musik eigentlich nicht zum Tanzen, sondern emotional geladenen Zuhören), moderato und „frisch“ – zusammen die bekannten „három a tánc“ (drei sind die Tänze). In den 1830er Jahren entwickelte sich aus den moderaten und schnellen Episoden des alten Magyars der Csárdás mit nur noch zwei Tempi. Er wurde für ein ganzes Jh., ja bis heute zum Identifizierungsmerkmal für das U.ische. Die Tanzfolgen, manchmal mit programmatischen Titeln, welche aber weniger an zeitgenössische Programmmusik, sondern seltsamerweise an barocke Programmsuiten erinnern, imitierten die u.ischen und internationalen Tanzfolgen des Ballsaales, führten aber nicht, wie erhofft, zur Ausbildung höherer Genres der symphonischen und der Kammermusik. Dies war bei dem hochentwickelten Stand der Instrumentalmusik im Zeitalter Beethovens auch nicht zu erwarten. Zu der Zeit, als der csárdás entstand, begann sich aus der alten Tanzmusik auch ein nationales Liedrepertoire zu entwickeln. Das u.ische Lied des 19. Jh.s, das seinerzeit entweder als magyar nóta oder schlicht Volkslied bezeichnet wurde, seit Bartóks und Kodálys Entdeckung des Bauernliedes aber nicht mehr ganz berechtigt als „Volkslied“ gelten darf, sondern „volkstümliches Lied“ genannt werden muss, erlangte über-ethnische Beliebtheit und eroberte ab 1843 auch die Musikbühne als Einlage in der äußerst populären Schauspielgattung des Volksstückes (Volkstheater). 1876 wurde in Pest das Nationaltheater eigens für dieses Genre geöffnet, das allerdings gegen Ende des Jh.s dem Vordringen der Operette in ihrer Pariser, Wiener und schließlich auch u.ischen Abart weichen musste. In der klassischen Zeit der magyar nóta schufen Liedkomponisten wie Kálmán Simonffy (1832–81) und József Szerdahelyi (1804–51) ein landesweit bekanntes Repertoire, aus dem viele Lieder von Bauern übernommen und als echte Volkslieder gesungen wurden. Um die Jh.wende traten neue Liedkomponisten auf, wie der Zigeunerprimas Dankó Pista (1858–1903) oder der Husarenkapitän Lóránd Fráter (1872–1930) und Árpád Balázs (1874–1941). Neue „Volkslieder“ (magyar nóta) wurden bis Mitte des 20. Jh.s massenweise komponiert. Unter ihrem Einfluss entstand ab den 1840er Jahren der echte Bauernliedstil (von Bartók „neuer Stil“ genannt). Der Freiheitskrieg von 1848/49 und die danach eingeführte allgemeine Wehrpflicht, schließlich die Befreiung der Leibeigenen und nachfolgende Kapitalisierung des Ackerbaues in Großgrundbesitz, die Massen von u.ischen und slowakischen Agrarproletariern mobilisierte, förderten die Verbreitung des Csárdás und des neuen Volksliedes rasch auf dem ganzen Landesgebiet, mit Ausnahme des konservativen Siebenbürgen, über ethnische Grenzen hinaus. Als z. B. Bartók 1906 im slowakischen Dorf Grlice in Nordungarn Volkslieder sammelte, fand er, dass die slowakischen Bauern fast nur neue u.ische Lieder in ihrer eigenen Sprache sangen. Das war keinem staatlichen Druck, sondern der Mode zuzuschreiben.
Beim tänzerisch-liedhaften Grundcharakter der u.ischen Nationalmusik nimmt es nicht wunder, dass die Bestrebung, auch die höheren Kunstgattungen für die nationale Musik (Nationalstil) zu erobern, bei den in U. lebenden Komponisten ihre ästhetisch wie kulturell größten Erfolge in den Vokalgattungen erreichte. Neben dem Kunstlied wie F. Erkels Nationallied (1842) auf eine Dichtung von József Eötvös (1813–71) oder der Vertonung des Szózat nach Mihály Vörösmarty (1800–55) durch B. Egressy (1814–51) wurde nach bescheidenen Anfängen um 1820, beginnend mit Erkels Bátori Mária (1840) und noch mehr seinem Hunyadi László (1844), die Oper zum eigentlichen Zentrum der u.ischen Nationalmusik großen Stils. Die Nationaloper wurde durch die Wahlungarn F. Doppler (Ilka, 1849) und Georg Kaiser/György Császár (A kunok, 1849) um erfolgreiche Werke leichteren Stils ergänzt und mit seinem Bánk bán (ca. 1850/61) gelang es Erkel, den elegischen liedhaften Nationalstil mit tragischen Emotionen zu durchdrängen und aus dem hochdramatischen Stoff eine erschütternde Operntragödie zu schaffen. Während Hunyadi László und Bánk bán bis heute dem u.ischen Opernrepertoire angehören, konnte M. Mosonyi, der sich erst spät auf Anraten Liszts mit dem u.ischen Nationalstil verband, mit seinem Szép Ilon (1861) keinen Durchbruch beim Publikum erringen. Wie Mosonyi selbst, versuchte die von ihm gegründete erste u.ische Musikzeitschrift Zenelap (1860–76) die Idee der Nationalmusik mit einem manchmal intoleranten Wagnerianismus, als obligatorischer Stilrichtung der Zukunft, produktiv zu verbinden. Diesem Credo schloss sich Ö. v. Mihalovich (1842–1929) an, der mit seiner Toldi (1888/90, nach dem Epos von János Arany [1817–82]) nur einen Achtungserfolg erringen konnte. Erkel selbst überließ in späteren Jahren die Instrumentation, dann zu immer größerem Anteil auch die Komposition der unter seinem Namen uraufgeführten Opern seinen musikalisch hochbegabten Söhnen Gyula und Sándor (beide Dirigenten, Sándor später auch Direktor der königlichen Oper); von den gewichtigen nach-Meyerbeerschen historischen Opern Dózsa György (1867) und Brankovics György (1874) wurde nur letztere in späteren Jahrzehnten mehrfach aufgeführt.
Die katholische Kirchenmusik entwickelte sich im 19. Jh. in den eingeschlagenen Bahnen weiter. Von den städtischen Chorleitern erlangten einige landesweiten Ruhm, z. B. die Brüder Ferenc (1819–87) und Endre (1824–82) Zsasskovszky in Erlau, A. Richter in Raab, J. A. Seyler (1778–1854) und sein Sohn Karl (1815–82) in Gran, Karl Angelus Winkhler (1786–1844) in Pest. In der 2. Hälfte des 19. Jh.s stellten kirchlich bzw. national repräsentative Ansprüche der katholischen Kirchenmusik neue Aufgaben, welche Liszt mit seinen beiden sollennen Messen mit reicher musikalischer Symbolik, mit seinem progressiven Stil aber nicht ganz den offiziellen Erwartungen gemäß löste (Graner Festmesse 1855/58, U.ische Krönungsmesse 1867). Seit dem Besuch J. Haydns und der Aufführung seiner Schöpfung 1800 am Budaer Hof des Palatins Josef, wurde das Oratorium als paraliturgische Andachtsgattung sowohl in Kirchen als auch in städtischen Theatern und Redouten während der Fastenzeit gepflegt. Neben Werken des traditionellen und neueren deutschen Repertoires wie Carl Heinrich Grauns Der Tod Jesu, Haydns Die Schöpfung und Sieben Worte, Beethovens Christus am Ölberge, Friedrich Schneiders Das Weltgericht, M. Stadlers Die Befreiung von Jerusalem oder Bernhard Kleins David wurden auch einige Neuigkeiten von lokalen Komponisten produziert, z. B. Die Befreiung von Jerusalem von Johann Spech (ca. 1767–1836), Das jüngste Gericht von V. F. Tuczek, Bonifazius von Louis Schindelmeisser (1811–64). In der 2. Jh.-Hälfte erfreuten sich Felix Mendelssohn Bartholdys Oratorien regelmäßiger Aufführungen. Zu einem besonderen Ereignis der sich festigenden, nunmehr betont national-u.ischen repräsentativen Musikpflege in Pest wurde die UA von Liszts Legende von der Heiligen Elisabeth in u.ischer Sprache in der neuen Pester Redoute durch ein riesiges, ad hoc zusammengestelltes Ensemble unter Leitung des Komponisten zum 25. Jubiläum des Bestehens des Nationalkonservatoriums, dessen Gründung seinerzeit der junge Liszt finanziell unterstützt hatte.
Liszts Künstlerruhm, sein musikalisches Schaffen und musikpolitisches Wirken, schließlich sein persönliches Charisma hatten für das u.ische Musikgeschehen vier Jahrzehnte lang eine Bedeutung, welche in einem Land, das sich aus einem österreichischen Provinzdasein zu nationalem Selbstbewusstsein entwickeln wollte, kaum überschätzt werden kann. Seit 1839 bekannte er sich zu seiner u.ischen Nationalität, leistete Unvergleichliches zur Institutionalisierung des musikalischen Unterrichts (Gründung des Nationalkonservatoriums 1840, Gründung der MAkad. 1875) und schuf mit seinen gänzlich „u.ischen“ Werken bzw. einzelnen Sätzen im style hongrois zweifellos den international weitaus bekanntesten u.ischen Beitrag zur europäischen Musik vor Bartók. Seine Musik im Allgemeinen mochte umstritten gewesen sein, gehörte aber in der 2. Jh.-Hälfte ohne Zweifel zu den musikalischen Erscheinungen erster Größenordnung, und da sein Ungartum allgemein bekannt war, sicherte er dadurch U. einen Platz im Konzert der Nationen, das um die Wende zum 20. Jh. über Europa hinaus globale Ausmaße annahm. In U. war Liszt in den letzten drei Dezennien seines Lebens stets präsent und stand zur Verfügung, bewahrte aber seine Unabhängigkeit und blieb so ein Beispiel dafür, wie ein Komponist gleichzeitig national fühlen und europäisch denken kann. Aus dieser Erkenntnis huldigte ihm Bartók, als er 1936 zum Mitglied der U.ischen Akademie der Wissenschaften gewählt wurde, mit einem Antrittsvortrag über „Liszt-Probleme“.
In der Instrumentalmusik versuchten nach Liszt Imre Székely (1823–87), der in Budapest ansässige Deutsche R. Volkmann, Sándor Bertha (1843–1912) u. a., die Motivik, Rhythmik und Harmonik des style hongrois in größeren musikalischen Formen unterzubringen. J. Joachim komponierte ein Violinkonzert in u.ischem Stil und spielte es mancherorts. J. Hubay, ein großartiger Violinist und Gründer der Budapester Geigerschule, verfolgte in seinen Opern und leichtflüssigen Instrumentalwerken internationale Stilideale mit nur gelegentlichen Abstechern in den Nationalstil (z. B. das berühmte Violinsolo in A cremonai hegedűs, 1894, die u.ische Volksoper A falu rossza, 1896). Dass J. Brahms den u.ischen Stil äußerst attraktiv fand und ihm neben den U.ischen Tänzen, die globale Popularität erlangen sollten, bis zu seinem späten Klarinettenquintett auch in Kammermusik und Konzert die Treue hielt, fanden u.ische Komponisten ehrenhaft und der Nachahmung wert. Eine Brahms nicht unwürdige Fusion anspruchsvoller musikalischer Faktur mit u.ischer Thematik und phantastischer Puszta-Stimmung erreichten E. v. Dohnányi in einigen Episoden seiner Frühwerke wie dem Andante seiner 1. Sinfonie sowie Bartók in seinem jugendlichen Klavierquintett und der Violinsonate. Ansonsten brachte U. zum Portrait der Doppelmonarchie auch in weniger exklusiven Gattungen charakteristisch exotische Farben bei. Wie im 18. Jh. vertrat das U.ische in der Musik der Monarchie immer noch das Orientalisch-Balkanische und auf der Bühne von Der Zigeunerbaron (J. Strauß Sohn) über die Cárdásfürstin (E. Kálmán) bis zur Arabella (R. Strauss), in der Mandryka seinem künftigen Schwiegervater mit dem u.isch-deutschen Maccaronitext „Teschek, bedien Dich“ sein Geld anbietet.
War der romantische u.ische Nationalismus eine größtenteils spontane Erscheinung, so ist nicht zu leugnen, dass nach dem österreich-u.ischen Ausgleich (1867) ein manchmal intoleranter Druck zur U.isierung einsetzte. U.ische oder sich zum Ungartum bekennende Leiter des nach deutschem Muster organisierten und bis dahin grundsätzlich deutschsprachigen Sängerbundes betrachteten die Sängerbewegung als Mittel dazu, was um 1880 zu Austritten von Chören führte. Widerstand von deutsch-österreichisch oder nur kaisertreu Gesinnten gegen die betont anti-österreichische Einstellung u.ischer Neonationalisten während und nach der Feier des Millenniums ist auch in höheren musikalischen Gattungen wach, wenn auch nicht laut geworden: z. B. die Parodie in c-Moll der Kaiserhymne Gott erhalte (Volkshymne) in Bartóks 1904 uraufgeführter Kossuth-Sinfonie wurde von einem Mitglied der Budapester Philharmoniker in seiner Instrumentalstimme mit dem Goethe-Zitat kommentiert: „Pfui! ein politisch Lied, ein garstig Lied“. Die deutschen Bewohner mancher Städte oder doch ihre Vertreter in der Lokalpresse nahmen nicht ohne Murren zur Kenntnis, dass im letzten Viertel des 19. Jh.s die Hauptsaison in den Theatern (die sächsischen Städte in Siebenbürgen ausgenommen) den u.ischen Theaterpächtern zugesichert wurde. Solche Konflikte ergaben sich hauptsächlich in Städten, nicht bei der nicht-u.ischen bäuerlichen Bevölkerung, deren Massen noch in „ihrem ethnologischen Traum“ (Pierre Nora) versunken waren. Andererseits entstanden sie auf dem ganzen historischen Landesgebiet, da die Magyaren als einzige Nationalität in U. überall in der urbanen Bevölkerung und durch die Präsenz des kleinen und mittleren Adels auch auf dem Lande heimisch waren. Diese ihre Allgegenwärtigkeit sollte 1921 die Aufteilung des Landes für die Magyaren doppelt unbegreiflich und schmerzlich machen.
Die rasche Entwicklung der Hauptstadt und der Auf- und Ausbau der musikalischen Institutionen nach 1867 zog musikalisch Interessierte und Begabte aus allen Landesteilen nach Budapest: symbolhaft für den Sog des neuen musikalisch-kulturellen Zentrums steht die Wahl des jungen Pressburger Musikadepten E. v. Dohnányi und von B. Bartók unmittelbar vor 1900 für die hiesige MAkad. anstelle der Wiener. Budapest zog aber auch angehende Musiker aus nichtmagyarischen Nationalitäten an. War es noch für Ö. v. Mihalovich, einen u.isch-kroatischen Adeligen und Anhänger Liszts, als Komponist gestandenen Wagnerianer, 1887–1919 Direktor der MAkad., eine gesellschaftliche Selbstverständlichkeit gewesen, Budapest als Lebenszentrum zu wählen, kam der gebürtige Kroate Josip Slavenski (Štolcer, 1896–1955) aus professionellen Gründen nach Budapest, wo er bis 1916 bei Kodály Komposition studierte, und besann sich wohl nach dessen und Bartóks Beispiel auf sein südslawisches (Jugoslawien) folkloristisches Erbe (er lebte fortan in Belgrad).
In der von Bartók und Kodály etwa 1906–08 initiierten Erneuerung der u.ischen Nationalmusik spielte die bewusste Hinwendung zur ungarländischen Bauernmusik eine entscheidende Rolle, deren Tragweite nur dann in vollem Maße bewertet werden kann, wenn man bedenkt, dass es sich dabei um einen vom europäischen tonalen Musikempfinden noch größtenteils unberührten Melodienschatz in archaischen Tonarten und einer freien bzw. nicht-quadratischen Rhythmik handelte und dass – was Bartók immer wieder betonte – die Musik vielerorts noch von unter fast mittelalterlichen Verhältnissen lebenden Bauerngemeinschaften getragen wurde. In der Bauernmusik entdeckte man also eine Exotik, die zugleich „heimisch“ war. Die Moderne, die Budapest um die Wende zum 20. Jh. erreichte, konnte mithilfe der archaischen Bauernmusik national umgedeutet oder interpretiert werden. Allerdings bedarf es der Betonung, dass Bartóks Bühnen- und Orchesterwerke, seine und Kodálys Klavierwerke, Kammermusik und Lieder in ihrem extremen Individualismus auch dem Geiste der Moderne entsprangen, dass es sich also bei ihrem Folklorismus bis nach Ende des Ersten Weltkrieges um keinen Ausdruck von gemeinschaftlich nationalen Emotionen handelte. Bartók unterstrich die Individualität seines stark expressiven Stils noch dadurch, dass er sich auch der Inspiration durch nicht-u.ische Bauernmusik aus dem Karpatenbecken öffnete, ja sogar arabische musikalische Impulse aus Nordafrika aufnahm, wo er 1913 eine Sammelreise unternommen hatte. Hinter Bartóks großem Interesse für die Musik der nichtmagyarischen ethnischen Gruppen in U. und seinen Kontakten zur Intelligenz der nationalen Minderheiten kann man außer der Faszination ihrer gegenüber der u.ischen noch archaischen Lebensweise und Stilistik auch die damals vielleicht noch nicht klar formulierte Idee vermuten, mit der musikalischen Integration der Bauernmusiken in seinem eigenen Werk symbolisch für die Erhaltung der damals bereits gefährdeten politischen Integrität des Vielvölkerstaates U. einzutreten. Als U. in seiner historisch gewachsenen Form nach dem Zusammenbruch 1918/21 doch nicht zu retten war, gab Bartók die Sammlung von Volksmusik im Karpatenbecken auf und widmete sich der Systematisierung der eigenen multiethnischen Sammlungen und der des großen u.ischen Volksliedwerkes, das er mit Kodály u. a. zustandebrachte. Ausmaß und Systematik der ethnomusikologischen Sammel- und Analysearbeit, welche Bartók und Kodály unermüdlich fortsetzten, wäre selbst für Fachwissenschaftler enorm gewesen, die keiner anderen Tätigkeit nachgingen. Für Komponisten ihres Ranges, die ab 1907 auch Klavier- bzw. Kompositionsunterricht an der MAkad. erteilten, war und bleibt sie wohl einzigartig.
Es war die in U. vielgeschmähte österreichisch-u.ische Symbiose, welche dem Vielvölkerstaat die letzten Jahrzehnte seiner unbeschwerten Existenz erlaubte und eine halbwegs europäische Modernisierung seiner wirtschaftlichen und kulturellen Strukturen sicherte. Auch die u.ische Avantgarde verdankte es in praktischer Hinsicht dem kommerziell fortgeschritteneren Österreich, dass sich für sie Tür und Tor zu Europa öffnete: 1918 nahm E. Hertzka Bartóks und Kodálys Werke in die Universal Edition auf. Nach dem gescheiterten Versuch der kommunistischen Machtübernahme etablierte sich im Nachkriegs-U. ein für Viele unsympathisches Regime mit desolaten Finanzen inmitten der unfreundlichen Umgebung der sog. Nachfolgestaaten. Von den zentralen musikalischen Institutionen war es die MAkad., die die politische und finanzielle Krise am schnellsten überwand: Dank ihres erstklassigen Lehrkörpers (Hubay, Dohnányi, Bartók, Kodály, Leó Weiner [1885–1960] u. a.) wurde sie zum weltweiten Lieferanten von hervorragenden Instrumentalisten und Sängern – z. T. auch erzwungenermaßen, da mit dem Verlust von fast allen u.isch-deutschen Musikstädten außer Budapest eine Überproduktion von Musikern einsetzte, welche nach dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise und der nationalsozialistischen Machtübernahme in Deutschland zu Musikerelend ausartete. 1925 wurde die Oper saniert und erlebte eine Glanzzeit, welche trotz erneuten Regimewechsels um 1949 bis Ende der 1950er Jahre dauern sollte. Die finanziellen Mittel des neuen Staates waren zwar beschränkt und die gesellschaftliche Einstellung grundsätzlich konservativ (der Historiker Gyula Szekfü bezeichnete sie zu Recht als neobarock); der weitsichtige Kulturpolitiker Kuno Graf Klebelsberg jedoch hatte erkannt, dass die Unterstützung von Kultur und Kunst unentbehrlich waren für die neue Selbstfindung U.s und des Ungartums, dessen Massen nun außerhalb der Landesgrenzen in neonationalistischen Staaten lebten. Wie seine Hinwendung zu den oratorischen Großformen und zur a cappella-Chormusik, ferner die von ihm wohl unter Einfluss der Jugendbewegung (Jugendmusikbewegung) initiierte Chorbewegung und sein erfolgreiches musikalisches Erziehungsprogramm zeigen, kam Kodály auf anderen Wegen zu demselben Ergebnis. Bartóks kompositorischer Weg führte nicht zu praktischer Massenhaftigkeit seiner Musik; über eine neobarocke Phase (1. und 2. Klavierkonzert, Cantata profana) erreichte er in den 1930er Jahren einen neuen Klassizismus. Dass das Lebenswerk beider auch international anerkannter Komponisten seinen Zenit jeweils in der Zwischenkriegszeit erreichte, sicherte der Musik in der u.ischen Kultur eine noch nie dagewesene Vormachtstellung. Dohnányi setzte die feine Reihe seiner konservativen Werke fort und war als Chefdirigent der Philharmoniker, ab 1934 Direktor der MAkad. und musikalischer Leiter des u.ischen Rundfunks die dominierende Instanz im Budapester Musikleben. Als Ergebnis der nunmehr seit Jahrzehnen ununterbrochen fortgesetzten musikalischen Ausbildung erschien in der Zwischenkriegszeit neben den Mitgliedern der älteren und mittleren Generation L. Weiner, László Lajtha (1892–1963), György Kósa (1897–1984), Sándor Jemnitz (1890–1963) u. a. eine wahre Phalanx von jungen Komponisten, die meisten Schüler Kodálys: Lajos Bárdos (1899–1986), Ferenc Szabó (1902–69), Pál Kadosa (1903–83), Zoltán Horusitzky (1903–85), Géza Frid (1904–89), István Szelényi (1904–72), Ferenc Farkas (1905–2000), Mátyás Seiber (1905–60), Zoltán Gárdonyi (1906–86), János Viski (1906–61), Sándor Veress (1907–92), György Ránki (1907–92), Endre Szervánszky (1911–77), Pál Járdányi (1920–66), Rudolf Maros (1917–82) u. a. In ihrer kompositorischen Richtung bezogen sich alle mehr oder weniger offen auf die u.ische „musikalische Muttersprache“, d. h. auf das ungarische Volkslied und den Stil von Bartók und Kodály. Mehrere unter ihnen zeigten aber bereits in der Jugend ihr persönliches Profil. Mit dem Auftreten einer zahlenmäßig derart starken zweiten Generation der emphatisch sog. „neuen u.ischen Musik“ – eigentlich zwei Generationen, denn die um 1900 geborenen älteren Schüler Kodálys trennten von den um und nach 1920 geborenen genau soviele Jahre wie die älteren vom 1882 geborenen Meister selbst – konnte sich im u.ischen kulturellen Milieu endgültig das Leitbild eines professionellen „u.ischen Komponisten“ befestigen, der sein Leben der sich immer neu stellenden Aufgaben der „Schöpfung von u.ischer Musik“ widmet und dafür hohen geistigen sowie mehr oder weniger ausreichenden materiellen Profit zieht.
In den Kriegsjahren 1942/43, als die Hoffnung bestand, dass sich U. aus dem unheimlichen Bündnis mit Deutschland lösen könne, ohne auf die zwischen 1938/41 zurückerhaltenen Gebiete wieder verzichten zu müssen, genossen Kodály und die moderne u.ische Musik nicht unbedeutende staatliche Förderung. Das professionelle Tätigkeitsfeld verbreiterte sich für die Komponisten auch dadurch, dass Klausenburg zurückkehrte und eine großzügig ausgestattete Oper sowie ein staatliches Konservatorium erhielt. Bartók nahm aus eigenem Entschluss an dem institutionellen Aufschwung während des Krieges nicht mehr teil, da er 1940 Europa für immer verlassen hatte. Aus dem Musikleben ausgeschlossen blieben zwischen 1939/45 Komponisten mosaischen Glaubens oder jüdischer Abstammung.
Es war die zweite Generation der neuen u.ischen Musik, welche dann zwischen 1948/55 die „heiße Phase“ der erzwungenen ästhetischen Ideologie des sozialistischen Realismus über sich ergehen lassen musste. Wäre die Geschichte anders verlaufen, hätten der vormalige Erzavantgardist Kadosa 1949 sicherlich keine Stalin-Kantate und Szervánszky keine Honvéd-Kantate komponiert. Es ist aber nicht auszuschließen, dass die klassisch-romantische Rückbesinnung des späten Bartók auch ohne das sozialistisch-realistische Diktat bei den meisten Komponisten eine wenn auch vorläufige populäre Wende hervorgerufen hätte. Die neorealistische Produktion der 1950er Jahre war zur Zeit der zweiten Avantgarde nach 1960 in Ungnade gefallen. Heutige postmoderne HörerInnen sprechen viele folkloristisch-klassizistische und/oder spätnational romantisch-expressive Instrumentalwerke der Zeit angenehm, z. T. auch emotional bindend an. Für viele führende Komponisten der zweiten Generation war jedoch die folkloristisch-realistische oder klassizistische Periode nur ein Intermezzo. Nach dem Aufstand von 1956 und der Lockerung der ästhetischen Einschränkungen wagte allen voran Szervánszky den Schritt über den Rubikon der Dodekaphonie (Zwölftontechnik) mit seinen Sechs Orchesterstücken (1959) und Variationen für Orchester (1964). Der damals 40-jährige Maros suchte Inspiration beim zeitlos „modernen“ Stil Bartóks der 1910er Jahre. András Szőllősy (* 1921), einer der letzten Kodály-Schüler, schuf sich aus Aleatorik und Farbenakkorden eine großformatige expressive orchestrale Sprache. Bereits Ende der 1950er Jahre trat György Kurtág (* 1926) mit seinen äußerlich verschlossenen und bis zur Schweigsamkeit disziplinierten, innerlich erschütternd emotionellen Kammermusikstücken und Liederzyklen hervor als der wohl bedeutendste Meister der u.ischen Neoavantgarde.
Obwohl die Wende von der folkloristisch-klassizistischen Kompositionsweise der 1930/50er zur programmatischen Avantgarde der 1960er Jahre generationsübergreifend erfolgte, verstanden sich die um 1930 geborenen Komponisten als „dritte Generation“ der „neuen u.ischen Musik“. Sie erwarben sich mit ihrer stark expressiven Ausdrucksweise ein bedeutendes Prestige in der nach polnischem Vorbild aufgeschlossener werdenden kulturellen Atmosphäre nach dem Aufstand von 1956. Nach der Abschottung zwischen etwa 1940 und 1960 begannen u.ische Komponisten wieder ihren angestammten Platz auf der internationalen Bühne der neuen Musik einzunehmen, nicht zuletzt weil ihre Werke durch den staatlichen Musikverlag Editio musica geschickt weltweit vertrieben wurden. Emil Petrovics (* 1930 Zrenjanin/Serbien [SRB], seit 1941 in U.) und Sándor Szokolay (* 1931 Kunágota/H) bereicherten mit C’est la guerre (1962) bzw. Vérnész/Bluthochzeit (1964) dauerhaft das sonst bescheidene nationale Opernschaffen. Zsolt Durkó (1934–97) schuf ein musikalisch wie moralisch autonomes Œuvre von Orchester- und Oratorien-Werken (Totenpredigt 1972). Den instrumentalen Farbenreichtum seiner Musik stellte Attila Bozay (1939–99) in seinen beiden Opern in den Dienst lyrisch-melodischer Durchleuchtung bedeutender Stücke des nationalen Dramas (Csongor und Tünde 1984 nach Mihály Vörösmarty, Fünf letzte Szenen 1999 nach der Tragödie des Menschen von Imre Madách). Die nationale Tradition spielt sowohl klanglich wie auch sujetmäßig eine bestimmende Rolle in den großformatigen Kompositionen von Sándor Balassa (* 1935 Budapest) und in der klanglich extrem attraktiven Musik von László Dubrovay (* 1943 Budapest).
Das mehr oder weniger einheitliche stilistische Selbstverständis der „neuen u.ischen Musik“ wurde durch das geschlossene Auftreten der nach 1940 Geborenen im Új Zenei Stúdió (Studio der neuen Musik) um 1970 aufgehoben. Zoltán Jeney (* 1943 Szolnok/H), László Sáry (* 1940 Győr), László Vidovszky (* 1944 Békéscsaba/H) u. a. wurden einerseits durch in U. bis dahin kaum rezipierte frühere Komponisten der Neuen Musik wie Charles Ives, Erik Satie oder John Cage inspiriert, andererseits eigneten sie sich neue kompositorische Methoden v. a. der zeitgenössischen amerikanischen Musik an (repetitive, minimal music, computergesteuertes Komponieren). Komposition und Performance nicht nur der eigenen Musik bildeten im Studio eine schöpferische Einheit. Das nonkonformistische musikalische Auftreten der Studiomitglieder wurde von Feind und Freund nicht zu Unrecht als bewusste Kündigung der „friedlichen Koexistenz“ von Kunst bzw. kulturpolitischem System interpretiert. Es überrascht nicht, dass die Postmoderne, welche spätestens mit János Vajdas (* 1949 Miskolc/H) Thomas Mann-Oper Mario und der Zauberer (1985) vor der breiten musikalischen Öffentlichkeit Flagge gezeigt hatte, ebenfalls als Phänomen der „Dissidenz“ verstanden wurde, besonders als Anfang der 1990er Jahre im Werk von György Orbán u. a. auch die liturgische Musik im Zeichen des Retro eine kompositorisch wie geistig glaubwürdige Wiedergeburt erlebte. 1947 in Neumarkt am Mieresch (ung. Marosvásárhely, Târgu Mureș/RO) geboren, gehört Orbán mit Veress, Viski, Szőllősy, Kurtág, Eötvös und nicht zuletzt auch G. Ligeti zu den Vertretern des Siebenbürger Ungartums in der Musik. Einige der Genannten, z. B. Veress oder Eötvös, waren nach dem Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg als Kleinkinder mit ihrer Familie nach U. emigriert, andere wie Viski, Szőllősy, Ligeti oder Kurtág, waren zum höheren Musikstudium an die MAkad. nach Budapest gekommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg blühte auch in Siebenbürgen eine u.ische Komponistenschule mit starken, aus der bodenständigen Tradition geschöpften Charakteristiken auf; zu ihr gehören u. a. Ede Terényi (* 1935 Tîrgu-Mureş), Csaba Szabó, Boldizsár Csiky (* 1937 Tîrgu-Mureş), Péter Vermesy.
Außer für die artifizielle Musik spielte die archaische Volksmusiktradition Siebenbürgens eine wichtige Rolle in den u.ischen folkloristischen Revivalbewegungen sowohl der Zwischenkriegszeit als auch ab den 1970er Jahren. Diese versuchten, eine für Viele attraktive Alternative zu den globalen Formen in der musikalisch-tänzerischen Unterhaltung der städtischen Bevölkerung zu etablieren. Die Operette, welche seit etwa 1870 als führende Gattung in der populären Musik dominiert und um 1900 bei Jenő Huszka (1875–1960), Pongrác Kacsoh (1873–1923) oder E. Kálmán, später bei Albert Szirmai (1880–1967) einen magyarisierenden Anhauch erhalten hatte, sowie das populäre u.ische Lied (magyar nóta) verloren im Zuge der Modernisierung nach 1960 ihre Faszination für die jüngere Generation fast völlig. Die von Kodály in der Zwischenkriegszeit initiierte Schulmusik- und Chorbewegung erreichte ihren Höhepunkt in den Jahrzehnten zwischen 1940/60. Kodálys musikerzieherisches Programm, ebenfalls in den 1940er Jahren systematisch ausgearbeitet, konnte zwar bedeutende Teilerfolge verbuchen, der Wunsch jedoch, sich gegen die grundlegenden internationalen Trends des musikalischen Konsums durchzusetzen, erwies sich als Illusion. Breiteren Nachklang hingegen fanden folkloristische und national-historisierende Spielarten der Rock- und Popmusik sowie der populären Musikbühne.
Literatur
Lit (v. a. nicht u.ische selbständige): MGG 9 (1998); NGroveD 11 (2001); ZeneiL 1–3 (1965); Z. Kodály/D. Bartha, Die u.ische Musik 1943; B. Szabolcsi, Gesch. der u.ischen Musik 1965 u. ö.; L. Dobszay, Abriss der u.ischen Musikgesch. 1993; I. Balázs, Musikführer durch U. 1991; G. Kroó, U.ische Musik gestern u. heute 1980; B. Bartók/Z. Kodály (Hg.), Corpus Musicae Popularis Hungaricae 1951ff; Monumenta Hungaricae Musica 1963ff; Z. Kodály et al. (Hg.), Stud. mus. 1961ff; Z. Falvy (Hg.), Musicologia Hungarica N. F. 1967ff; Musicalia Danubiana 1982ff; L. Dobszay et al. (Hg.), Musicalia Danubiana. Subsidia 2000ff; J. Szendrei et al. (Hg.), Magyar Gregorianum. Cantus Gregorianus ex Hungaria1981; Z. Falvy/L. Mezey, Codex Albensis: ein Antiphonar aus dem 12. Jh. 1963; B. Szabolcsi, Tanzmusik aus U. im 16. u. 17. Jh. 1970; B. Bartók, Das u.ische Volkslied 1925; L. Dobszay/J. Szendrei, Catalogue of Hungarian Folksong Types 1992; B. Sárosi, Die Volksmusikinstrumente U.s 1967; B. Sárosi, Sackpfeifer, Zigeunermusikanten ... die instrumentale u.ische Volksmusik 1996; M. Steward, Time of the Gypsis 1997; K. Benda et al. (Hg.), Die Gesch. U.s von den Anfängen bis zur Gegenwart 1988; G. Staud, Adelstheater in U. (18. u. 19. Jh.) 1977.
Lit (v. a. nicht u.ische selbständige): MGG 9 (1998); NGroveD 11 (2001); ZeneiL 1–3 (1965); Z. Kodály/D. Bartha, Die u.ische Musik 1943; B. Szabolcsi, Gesch. der u.ischen Musik 1965 u. ö.; L. Dobszay, Abriss der u.ischen Musikgesch. 1993; I. Balázs, Musikführer durch U. 1991; G. Kroó, U.ische Musik gestern u. heute 1980; B. Bartók/Z. Kodály (Hg.), Corpus Musicae Popularis Hungaricae 1951ff; Monumenta Hungaricae Musica 1963ff; Z. Kodály et al. (Hg.), Stud. mus. 1961ff; Z. Falvy (Hg.), Musicologia Hungarica N. F. 1967ff; Musicalia Danubiana 1982ff; L. Dobszay et al. (Hg.), Musicalia Danubiana. Subsidia 2000ff; J. Szendrei et al. (Hg.), Magyar Gregorianum. Cantus Gregorianus ex Hungaria1981; Z. Falvy/L. Mezey, Codex Albensis: ein Antiphonar aus dem 12. Jh. 1963; B. Szabolcsi, Tanzmusik aus U. im 16. u. 17. Jh. 1970; B. Bartók, Das u.ische Volkslied 1925; L. Dobszay/J. Szendrei, Catalogue of Hungarian Folksong Types 1992; B. Sárosi, Die Volksmusikinstrumente U.s 1967; B. Sárosi, Sackpfeifer, Zigeunermusikanten ... die instrumentale u.ische Volksmusik 1996; M. Steward, Time of the Gypsis 1997; K. Benda et al. (Hg.), Die Gesch. U.s von den Anfängen bis zur Gegenwart 1988; G. Staud, Adelstheater in U. (18. u. 19. Jh.) 1977.
Autor*innen
Tibor Tallián
Rudolf Flotzinger
Rudolf Flotzinger
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Tibor Tallián/Rudolf Flotzinger,
Art. „Ungarn (deutsch für ungarisch Magyarország)‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e544
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.