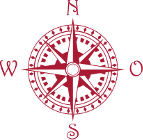Schlager
Ganz allgemein die Bezeichnung für ein Musikstück mit rasch eintretendem und anhaltendem Erfolg bei einem breiten Publikum, in einem engeren Sinn bezogen auf Erscheinungsformen der Popularmusik und dabei wiederum in erster Linie auf Lieder. Eine erneute Eingrenzung im Hinblick auf Österreich (mit Einschränkungen auch für Deutschland gültig) brachte der allgemeine Sprachgebrauch seit Mitte der 1960er Jahre durch die Fokussierung auf deutschsprachige Lieder, die in der publizistischen Darstellung der internationalen Popproduktion (deren Erfolgsnummern demgemäß als „Hits“ firmierten) gegenübergestellt wurden. Eine weitere spezielle Verwendung des Begriffs ist im Rahmen der volkstümlichen Musik seit Anfang der 1980er Jahre festzustellen (Schlager, volkstümlicher).
Der Begriff, zunächst wohl im Wirtschaftsleben gebräuchlich, scheint im Hinblick auf musikalische Erzeugnisse seinen Ursprung im Wien des 19. Jh.s zu haben. Im Zusammenhang mit der rasanten Metropolenwerdung war hier ein rasch expandierendes Angebot professioneller urbaner Unterhaltung entstanden. Namentlich Einzelstücke aus Operetten wurden vor diesem Hintergrund um 1870 bereits als Sch. apostrophiert. „Zündende Melodien – Sch. nennt sie der Wiener“ heißt es in der Wiener National-Zeitung 1881. In der Folge zeigt sich beispielsweise bei Joh. Strauß Sohn die deutliche Tendenz, derartige „Zugnummern“ mehrfach zu verwenden, etwa in der Platzierung von zuvor bereits erfolgreichen Tanzstücken (dabei oft nachträglich textiert) in Operetten bzw. umgekehrt in Form der „Auskoppelung“ von Operettennummern als (nunmehr instrumentale) Tanzstücke. Ein Beispiel für diese Praxis ist die Annen-Polka, die als Schwipslied eine zweite Karriere erlebte und darüber hinaus zu den anscheinend unverzichtbaren Sch.n des „Wiener Repertoires“ (weitergewälzt etwa im Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker) zu rechnen ist. Einen Höhepunkt dieser Spekulation auf die Sch.-Qualitäten etablierter Kompositionen stellen diejenigen Wiener Operetten seit Wiener Blut (1899) dar, die sich musikalisch aus dem Fundus verstorbener (Wiener) Komponisten bedienten und sie meist mit „Alt-Wiener“ Sujets koppelten. Früh zeigt sich auch eine Bindung des Sch.s an exponierte InterpretInnen, im Fall der Wiener Unterhaltungsindustrie wäre dafür in besonderer Weise A. Girardi namhaft zu machen. Nicht zuletzt durch den Erfolg groß aufgezogener Unterhaltungsunternehmen wie Venedig in Wien kam es zu einer Ausweitung des Sch.-Begriffs weit über den Operettenbereich hinaus, besonders nachhaltig dabei in Richtung „Wiener“ Musik, aber durchaus auch Oper (namentlich der aktuelle Verismo war davon betroffen), wiederum in erster Linie über InterpretInnen vermittelt. Ein wesentliches Charakteristikum des Sch.s ist ferner seine Eingebundenheit in das speziell in Wien seit der Wende zum 20. Jh. verstärkt normbildende System der Arbeitsteilung bei der Herstellung unterhaltender Musik (arbeitsteiliges Zusammenwirken von jeweils spezialisierten Komponisten, Textautoren, Arrangeuren und InterpretInnen). Die konsequenteste Anwendung dieses Prinzips erfolgte im 20. Jh. in der über Jahrzehnte die US-Produktion bestimmenden Praxis der New Yorker Tin Pan Alley.
Nachdem bereits in den 1910er Jahren vereinzelt eine gewisse Konzentration auf die Herstellung von Sch.-Liedern zu bemerken ist – beispielhaft sind dafür erfolgreiche Kompositionen des aus der Operettenszene kommenden R. Stolz, charakteristischerweise stilistisch aus unterschiedlichsten Quellen schöpfend, wie etwa das vom Chanson herkommende Servus Du (1911) oder die früh (1919) die Rezeption überseeischer Modetänze markierende Salome –, stellt die Revuekultur der 1920er Jahre (deren produktives Zentrum zwar eindeutig Berlin war, die Wiener Beiträge dazu erwiesen sich jedoch als äußerst wichtig) ein besonders attraktives Anwendungsfeld dar. Mit dem raschen Aufstieg des neuen Mediums Rundfunk (E. Arnold wurde der erste Wiener Star des neuen Phänomens „Radio-Sch.“, Schlagertexte wie Die schöne Adrienne hat eine Hochantenne feierten neue Errungenschaften) war seit der Mitte des Jahrzehnts ein weiterer struktureller Fixpunkt der Sch.-Produktion gegeben. Die Rücksichtnahme auf technische mediale Voraussetzungen (zeitliche Beschränkung der Aufnahmedauer von Schallplatten) in Verbindung mit der Orientierung am zunehmend bestimmenden Starkult wirkte gleichzeitig auch auf die Operettenproduktion zurück, besonders markant in den von F. Lehár seit Paganini seinem männlichen Star auf den Leib geschriebenen „Tauberliedern“, die auch sämtlich zu Sch.n in Rundfunk und auf Schallplatte avancierten (z. B. Gern hab ich die Frau’n geküsst, Wolgalied, Dein ist mein ganzes Herz). Das Auftreten von Operetten- und Opernstars als InterpretInnen von Sch.n (R. Tauber, Jos. Schmidt, J. Kiepura, F. Massary) ist eine Folge dieser Tendenz (jedoch gelangten auch gänzlich gegensätzliche Stimmkonzepte weit abseits vom Belcanto zu Sch.-Ehren, etwa in Gestalt von Heinz Rühmann und H. Moser), eine weitere wäre in der geplanten Sch.-Anhäufung in einem Bühnenwerk durch Kooperation ausgewiesener Experten des Genres zu sehen, manifestiert im anhaltenden Erfolg der Gemeinschaftsproduktion Im weißen Rössl (1931, musikalische Beiträge steuerten neben dem Hauptkomponisten R. Benatzky die Genrespezialisten Robert Gilbert, B. Granichstaedten und R. Stolz bei). Folgerichtig sah sich der Sch. auch sofort in zentraler Rolle des neuen Mediums Tonfilm (Tonfilm-Sch.; Film, Musikfilm), „rund um einen Sch. komponierte“ Werke (Die 3 von der Tankstelle mit dem Haupt-Sch. Ein Freund, ein guter Freund; Quax der Bruchpilot mit Heimat, deine Sterne seien als Beispiele der deutschen Filmproduktion der 1930/40er Jahre genannt, aus österreichischer Sicht ist auch hierbei R. Stolz als wesentlicher Exponent der Szene zu erwähnen) wurden dabei oftmals zur Norm und ermöglichten die medienübergreifende Rezeption und „gegenseitige Bewerbung“ (der meist von einem gefeierten Interpreten kreierte Sch. wirbt für den Film, der Film macht den Sch. zusätzlich populär), damit eine speziell im aktuellen US-Publikumsfilm heute (2005) geltende Norm vorwegnehmend. Die Breite des mit dem Sch. bereits spätestens um 1930 zu assoziierenden InterpretInnen- und Stilfelds (von „lokaltypischen“ Erscheinungen der Wiener und Berliner Szene wie E. Arnold und H. Leopoldi oder J. Selim und Claire Waldoff bis hin zu im deutschsprachigen Raum neuartigen Anknüpfungen an erfolgreiche US-Konzepte wie die Comedian Harmonists) lässt eine nur einigermaßen befriedigende Charakterisierung nach engeren musikalisch-stilistischen Kategorien nicht mehr zu. Die Sch.-Branche orientierte sich vielmehr ausschließlich am Kriterium der Marktmaximierung, wobei damit (noch) nicht notwendigerweise eine vollkommene Ausrichtung am jeweils niedrigsten Niveau einherging (was sich u. a. im Vorhandensein von Ironie, Wortwitz und vereinzelt auch unterschwelliger Gesellschaftskritik äußerte, etwa in Sch.-Texten der 1920er Jahre von F. Grünbaum, F. Löhner-Beda u. a.). Vollkommen üblich war auch damals bereits die Eindeutschung internationalen Repertoires, in erster Linie aus der Tin Pan Alley-Produktion und meist unzutreffend mit „Jazz“ apostrophiert.
Die Machtergreifung der Nationalsozialisten führte einerseits zu einem enormen Verlust an kreativem Potential durch die Verfolgung bzw. Flucht (Exil) wesentlicher Exponenten der Branche. Die Flucht führte dabei oft über Österreich als erste Station nach Frankreich und weiter in die USA, wo mitunter außergewöhnliche Karrieren glückten, etwa die des Wieners W. Jurmann, der mit Veronika, der Lenz ist da eine der Ikonen des Repertoires der Comedian Harmonists geschrieben hatte und sich in der Emigration mit San Francisco1936 mit einem wahrhaften „Welt-Sch.“ – bezeichnenderweise für einen Film – einführte, sein noch in Berlin entstandenes Lied Ninon machte der ebenfalls emigrierte Widmungsträger Kiepura in den USA höchst populär. Andererseits kam es zu einer bewussten politischen Indienstnahme des Sch.s und seiner verbliebenen, nunmehr mit dem Regime kooperierenden Produzenten durch die nationalsozialistische Kulturpolitik. Bis zum Kriegsausbruch war der Sch. im NS-System für die Verbreitung guter Stimmung zuständig, während des Krieges dann in konsequenter Steigerung für Ablenkung und „Hoffnung“ in speziellen Programmschienen im Rundfunk (Joseph Goebbels: „optimistischer Sch.“, möglicherweise etwas zu eindimensional personifiziert in Zarah Leander, die nach ihrem Durchbruch in Wien Mitte der 1930er Jahre eine schillernde Zentralfigur der reichsdeutschen Sch.- und Filmkultur geworden war). Charakteristischerweise blieben diese Elaborate (trotz der offensichtlichen Zweckwidmung als „Durchhalte-Sch.“ in Verfolgung des Goebbels’schen Programms von der politischen Relevanz des „angeblich Unpolitischen“) auch nach Kriegsende in Deutschland und Österreich ungebrochen populär – vereinzelt ist jedoch durchaus die Möglichkeit einer Mehrfachkodierung zu konzedieren, z. B. in Davon geht die Welt nicht unter oder Ich weiß, es wird einmal ein Wunder gescheh’n – und etablierten sich als „deutsche Evergreens“.
Eine generell in der Kultur der Nachkriegsjahre feststellbare große Bereitschaft, auf Illusions- und Ablenkungsangebote einzugehen, findet sich massiv in der deutschen und österreichischen Sch.-Produktion: Exotismus, Realitätsverweigerung und Traumwelten dominieren die Texte, die „Südsee“ und ferne Liebesinseln sind feste Versatzstücke der Nachkriegsschlagerlyrik. Musikalisch wird die Tendenz zur Rezeption möglichst vieler internationaler Stile fortgesetzt, darunter eine nun verstärkt auftretende Auseinandersetzung mit lateinamerikanischen Einflüssen, meist auf oberflächlicher Basis, oft lediglich als Reizwort (Samba, Rumba, Mambo) ohne musikalisch konkrete Entsprechung im Produkt. Die schon in der Revuekultur der 1920er Jahre feststellbare Einheit deutscher und österreichischer Produktion wird nun noch intensiviert, sodass von einem tendenziell einheitlichen deutschsprachigen Sch.-Markt gesprochen werden muss. Österreich ist hierbei v. a. mit erfolgreichen InterpretInnen vertreten (P. Alexander, Lolita, F. Quinn), aber auch als pittoresker und klischeebefrachteter Schauplatz zahlloser Sch.- und nach Sch.-Kriterien hergestellter Operettenfilme seit Mitte der 1950er Jahre (Spitzenränge nehmen dabei der Wörthersee, die Wachau, die Tiroler Bergwelt, das Salzkammergut und Wien ein). Nicht zuletzt auf dieser Schiene erfolgt aber auch eine neue Platzierung von „Lokaltypik“, freilich zunächst fast ausschließlich in den bis auf einzelne Dialektbegriffe grundsätzlich hochsprachlichen Texten (als Bezugnahme auf Alpenklischees, regionale Besonderheiten und besonders den Fremdenverkehr im Sinn eines „Binnenexotismus“ [Werbung]), was zu skurrilen Verbindungen wie „Jodelfox“ und „Alpen-Raspa“ führt und eine der historischen Grundlagen der anhaltend erfolgreichen volkstümlichen Produktion darstellt. Daneben wirkten in Österreich auch Vorkriegsschlagertraditionen, personifiziert in den aus der Emigration zurückgekehrten H. Leopoldi und R. Stolz (dessen z. T. schon aus den 1920er Jahren stammende Sch. in den Arrangements von K. Grell und B. Uher neuerlich populär wurden) und sich z. T. kaum vom „Wienerlied“ abgrenzen lassen (was auch für die zahlreichen Sch.-Lieder von H. Lang gilt).
Sch.-Kompatibilität war in den 1950/60er Jahren aber auch für Exponenten gänzlich anderer Richtungen mitunter wesentlich, etwa für den heimischen Mainstream-Jazz: das Wiener Tanz Orchester (WTO), das in den frühen 1950er Jahren durchaus als jazzmäßige Formation anzusprechen ist, konnte beispielsweise nicht zuletzt durch den Erfolg mit Sch.n (die wie Ein kleiner Bär mit großen Ohren von Bandmitglied E. Halletz auf die Crooner-Qualitäten des Bandleaders H. Winter abgestellt waren) eine über den damals sehr begrenzten heimischen Jazzkreis weit hinausreichende Popularität erreichen, und der als Big Band-Leiter zu Recht hervorgehobene J. Fehring schrieb zahlreiche Arrangements zu den erwähnten Sch.-Filmen. Waren diese Grenzüberschreitungen v. a. ökonomischen Zwängen geschuldet, so brachte der Kabarettist, Komponist und Autor G. Bronner – dessen Kabarettkompositionen Der g’schupfte Ferdl, Der Papa wird’s schon richten und Der Halbwilde als absolutes Novum in der Branche selbst zu veritablen Sch.n geworden waren (mit dem Interpreten H. Qualtinger gab es auch einen Star dazu) – mit seiner langjährigen Rundfunksendung Sch. für Fortgeschrittene bewusst die Idee eines „niveauvollen“ Sch.s ins Publikum, freilich lag dabei das Hauptaugenmerk auf der Vorstellung hierzulande kaum beachteter internationaler Produkte von der US-Mainstream-Jazz-Szene bis hin zu Antonio Carlos Jobims Bossa Nova. Bronner hatte im Kabarett zuvor in beißender Satire die Verfertigung eines „typischen Sch.s“ vorgeführt und er war es auch, der mit dem Dialekttext zu A Glock’n (1970, M: ORF Big Band-Saxophonist H. Salomon, Interpretin: M. Mendt) einen der ersten Sch. (die jedoch nunmehr „Hits“ heißen sollten) der jungen heimischen Popszene aus der Taufe hob. In der Folge avancierten zahlreiche Produkte namentlich des sog. „Austro-Pop“ zu funktionalen Sch.n und zu „Generationenliedern“ (Es lebe der Zentralfriedhof, Schifoan, Tagwache), auch wenn für diese wie erwähnt nicht mehr der Begriff Sch. verwendet wurde. Dieser blieb nun tendenziell auf die Erzeugnisse der etablierten deutschen (grenzüberschreitenden) Liedindustrie beschränkt, wobei die Abgrenzung durchaus drastisch ausfallen konnte, wie am Beispiel des legendären „Schnulzenerlasses“ (der neue „Jugendsender“ Ö3 sollte von den Erzeugnissen des deutschen Sch.-Marktes unbeschädigt bleiben und sich der der jugendlichen Zielgruppe adäquaten internationalen Pop- und Folkszene öffnen) des damaligen Generalintendanten des ORF, Gerd Bacher, Ende der 1960er Jahre zu zeigen ist. Terminologische und stilistische Unschärfen blieben jedoch, ganz offensichtlich in der Praxis des European Song Contest in den 1960/70er Jahren, personifizierbar in der Gestalt des bislang einzigen österreichischen Songcontestsiegers U. Jürgens, aus dessen Schaffen einige Lieder als die tendenziell niedrigen Genrestandards ostentativ achtende, somit „intendierte“ Sch. zu werten sind (Buenos Dias, Argentina), andere aber trotz deren offensichtlicher Widerständigkeiten dennoch zu funktionalen Sch.n avancieren und damit zumindest partiell niveaukorrigierend wirken konnten (Das ehrenwerte Haus). Seit den frühen 1980er Jahren ist der „volkstümliche“ Schlager ein Erfolg versprechender Schwerpunkt heimischer Popularmusikproduktion.
Literatur
W. Haas, Das Sch.-Buch 1957; Th. W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie 1962; H. C. Worbs, Der Sch. 1963; S. Helms (Hg.), Sch. in Deutschland 1972; H. Rauhe, Popularität in der Musik 1974; D. Kayser, Das Lied als Ware. Untersuchungen zu einer Kategorie der Illusionsindustrie 1975; F.-P. Kothes, Die theatralische Revue in Berlin und Wien 1900–1938, 1977; Honegger/Massenkeil 1978; V. Kühn in H. W. Heister/H. G. Klein (Hg.), Musik und Musikpolitik im faschistischen Deutschland 1984; F. Patzer (Hg.), „Das gab’s nur einmal…“ Die Sch. der 20er Jahre 1987; Hb. der populären Musik 1997; S. Schutte (Hg.), Ich will aber gerade vom Leben singen... Über populäre Musik vom ausgehenden 19. Jh. bis zum Ende der Weimarer Republik 1987; E. v. Berswordt (Hg.), Chronik dt. Unterhaltungsmusik 1991; Ch. Glanz in M. Brodl (Hg.), Sommerakad. Volkskultur 1992; Das Lex. des dt. Sch.s 1993; Ch. Seiler (Hg.), Schräg dahoam. Zur Zukunft der Volksmusik 1995; N. Rubey/P. Schoenwald, Venedig in Wien. Theater- und Vergnügungsstadt der Jh.wende 1996; P. Gronow/I. Saunio, An International History of the Recording Industry 1998; Ch. Glanz in B. Denscher (Hg.), Kunst und Kultur in Österreich. Das 20. Jh. 1999; W. Dietrich, Samba Samba. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung zur fernen Erotik Lateinamerikas in den Sch.n des 20. Jh.s 2002; E. Semrau, Robert Stolz 2002; B. Denscher/H. Peschina, Kein Land des Lächelns. Fritz Löhner-Beda 1883–1942, 2002; P. Tschmuck, Kreativität und Innovation in der Musikindustrie 2003; Ch. Glanz in W. Kos/C. Rapp (Hg.), [Kat.] Alt-Wien. Die Stadt, die niemals war 2004; E. Barta/R. Westphal, Hallo! Swing-Swing! 2004.
W. Haas, Das Sch.-Buch 1957; Th. W. Adorno, Einleitung in die Musiksoziologie 1962; H. C. Worbs, Der Sch. 1963; S. Helms (Hg.), Sch. in Deutschland 1972; H. Rauhe, Popularität in der Musik 1974; D. Kayser, Das Lied als Ware. Untersuchungen zu einer Kategorie der Illusionsindustrie 1975; F.-P. Kothes, Die theatralische Revue in Berlin und Wien 1900–1938, 1977; Honegger/Massenkeil 1978; V. Kühn in H. W. Heister/H. G. Klein (Hg.), Musik und Musikpolitik im faschistischen Deutschland 1984; F. Patzer (Hg.), „Das gab’s nur einmal…“ Die Sch. der 20er Jahre 1987; Hb. der populären Musik 1997; S. Schutte (Hg.), Ich will aber gerade vom Leben singen... Über populäre Musik vom ausgehenden 19. Jh. bis zum Ende der Weimarer Republik 1987; E. v. Berswordt (Hg.), Chronik dt. Unterhaltungsmusik 1991; Ch. Glanz in M. Brodl (Hg.), Sommerakad. Volkskultur 1992; Das Lex. des dt. Sch.s 1993; Ch. Seiler (Hg.), Schräg dahoam. Zur Zukunft der Volksmusik 1995; N. Rubey/P. Schoenwald, Venedig in Wien. Theater- und Vergnügungsstadt der Jh.wende 1996; P. Gronow/I. Saunio, An International History of the Recording Industry 1998; Ch. Glanz in B. Denscher (Hg.), Kunst und Kultur in Österreich. Das 20. Jh. 1999; W. Dietrich, Samba Samba. Eine politikwissenschaftliche Untersuchung zur fernen Erotik Lateinamerikas in den Sch.n des 20. Jh.s 2002; E. Semrau, Robert Stolz 2002; B. Denscher/H. Peschina, Kein Land des Lächelns. Fritz Löhner-Beda 1883–1942, 2002; P. Tschmuck, Kreativität und Innovation in der Musikindustrie 2003; Ch. Glanz in W. Kos/C. Rapp (Hg.), [Kat.] Alt-Wien. Die Stadt, die niemals war 2004; E. Barta/R. Westphal, Hallo! Swing-Swing! 2004.
Autor*innen
Christian Glanz
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Christian Glanz,
Art. „Schlager‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e0e7
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.