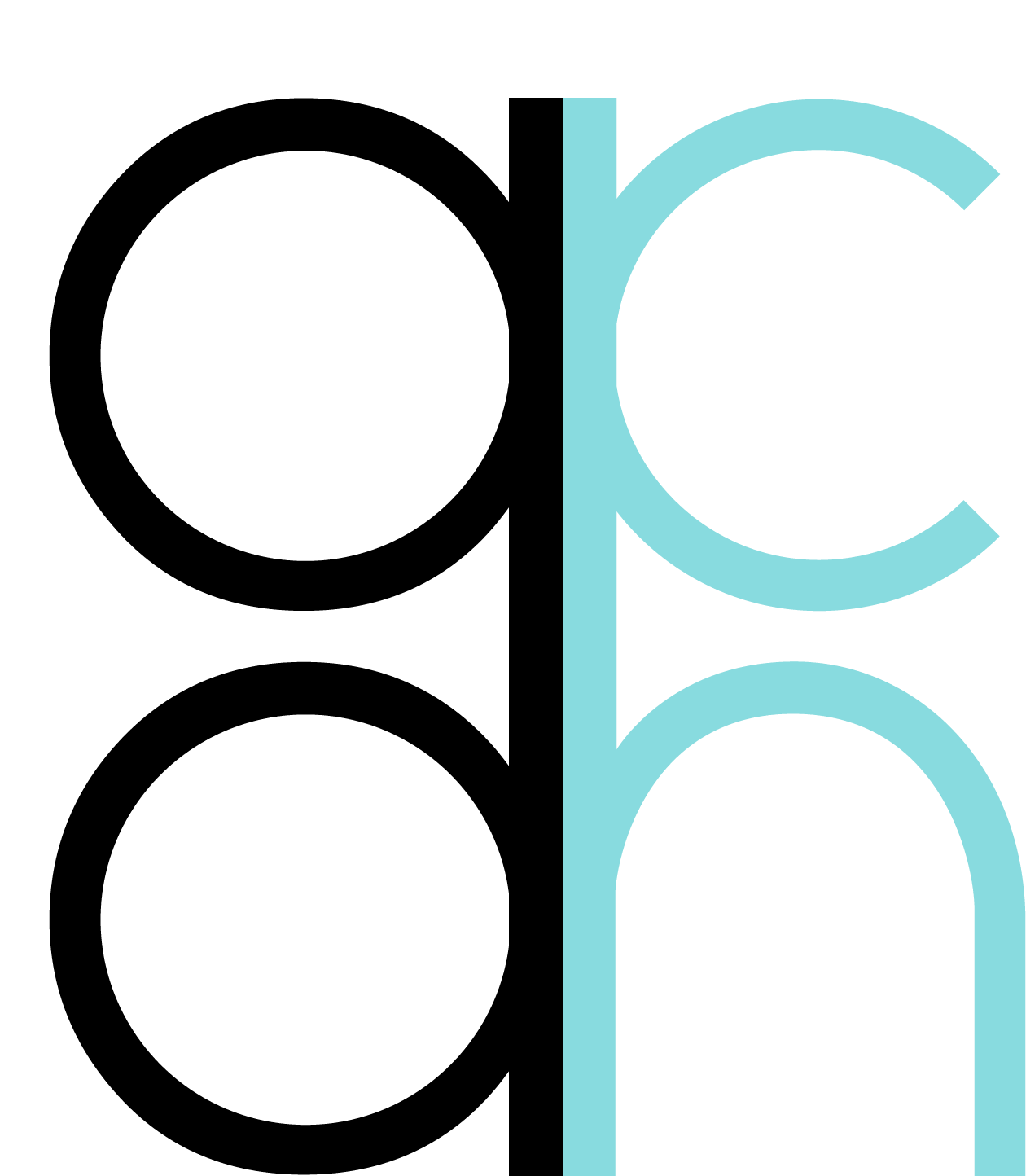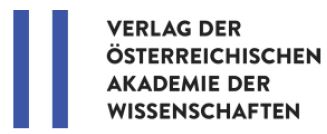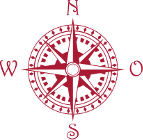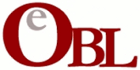Brentano,
Franz
* 16.1.1838 Marienberg bei Boppard am Rhein/D,
† 17.3.1917 Zürich/CH.
Philosoph und Psychologe.
Katholischer Priester, ab 1872 Prof. für Philosophie in Würzburg, ab 1874 Prof. für Philosophie an der Univ. Wien, 1880 Verlust der Professur (wegen Austritts aus der katholischen Kirche und Verehelichung), bis 1895 Privatdozent in Wien, danach Privatgelehrter (in Italien, später in der Schweiz), 1903 vollständige Erblindung.Hauptsächlich von Aristoteles und Thomas von Aquin, z. T. auch von Gottfried Wilhelm Leibniz beeinflusst, steht B. – in für die österreichische Philosophietradition kennzeichnender Weise – in strikter Opposition zum deutschen Idealismus, besonders zu Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
B.s Ansichten zur Ästhetik wurden erst Jahrzehnte nach seinem Tod in einer nicht unumstrittenen Edition zusammengefasst: B. bekennt sich – in ausdrücklicher Abgrenzung zur Formalästhetik Johann Friedrich Herbarts – zu einer empiristischen, d. h. in seiner Terminologie psychologistischen Auffassung von Ästhetik, die er gleichwohl als verbindlich und normativ auffasst, da er alle Vorstellungen als allgemein gültig versteht: Das „Schöne“ wird – in Form der Erregung eines besonders hohen Maßes an individuellem Wohlgefallen – mit unmittelbarer Evidenz vom minder Schönen oder nicht Schönen unterschieden, da mit dem unmittelbaren Gefallen einer Vorstellung in der ästhetischen Wahrnehmung zugleich die Einsicht in die Berechtigung dieses Gefallens einhergeht. Sätze der Ästhetik sind demnach – wiewohl psychologisch bedingt – von zwingend notwendigem Charakter, ihre jeweils konkrete Erkenntnis ist aber vom Geschick des Künstlers und vom Erkenntnisvermögen (Geschmack) des Rezipienten – das angeboren ist, jedoch geschult und verfeinert werden muss – abhängig. Ästhetik ist für B. – in offener Anlehnung an Aristoteles – „eine praktische Disziplin, welche uns lehrt, mit richtigem Geschmack Schönes und Unschönes zu empfinden, das Schöne vor dem minder Schönen zu bevorzugen, und uns Anweisungen gibt, um es hervorzubringen“.
In seiner nach dem „Grade der Geistigkeit“ vorgenommenen Einteilung der künstlerischen Disziplinen platziert B. die Musik hinter der Poesie, der aufgrund ihrer begriffsbildenden Tätigkeit der erste Platz zukommt, und der bildenden Kunst, die durch ihre Gestaltungskraft das bildliche Denken anregt, an letzter Stelle, da sie – seiner Auffassung nach – über das angenehme Gefühl, das sie durch ihre Geordnetheit hervorruft, und über die Erregung von Affekten mehr die Sinne als das begrifflich-intellektuelle Denken anspricht.„Der Kunst, die sich an das Ohr wendet, der Musik, gebührt, so schätzbar sie uns ist, entschieden die letzte Stelle.“ Mit polemischen Seitenhieben gegen Rich. Wagner, auch gegen F. Nietzsche und A. Schopenhauer, interpretiert B. daher das von ihm in seiner Gegenwart wahrgenommene „Überwuchern der Musik als [...] Décadence-Erscheinung der Gesellschaft“, womit er, obwohl von völlig anderen Voraussetzungen ausgehend, bei denselben Werturteilen anlangt, wie die zu seiner Zeit in Österreich dominierende, formalästhetisch argumentierende Tradition um R. Zimmermann und E. Hanslick.
Schriften
Grundzüge der Ästhetik, hg. v. F. Mayer-Hillebrand 1959.
Grundzüge der Ästhetik, hg. v. F. Mayer-Hillebrand 1959.
Literatur
G. W. Cernoch in M. Benedikt/R. Knoll (Hg.), Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung 3 (1995); W. Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie 21960,1–48; Chr. Allesch in Brentano-Studien 2 (1989); R. Haller in Brentano-Studien 5 (1994).
G. W. Cernoch in M. Benedikt/R. Knoll (Hg.), Verdrängter Humanismus – Verzögerte Aufklärung 3 (1995); W. Stegmüller, Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie 21960,1–48; Chr. Allesch in Brentano-Studien 2 (1989); R. Haller in Brentano-Studien 5 (1994).
Autor*innen
Peter Stachel
Letzte inhaltliche Änderung
18.2.2002
Empfohlene Zitierweise
Peter Stachel,
Art. „Brentano, Franz‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
18.2.2002, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001f94d
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.