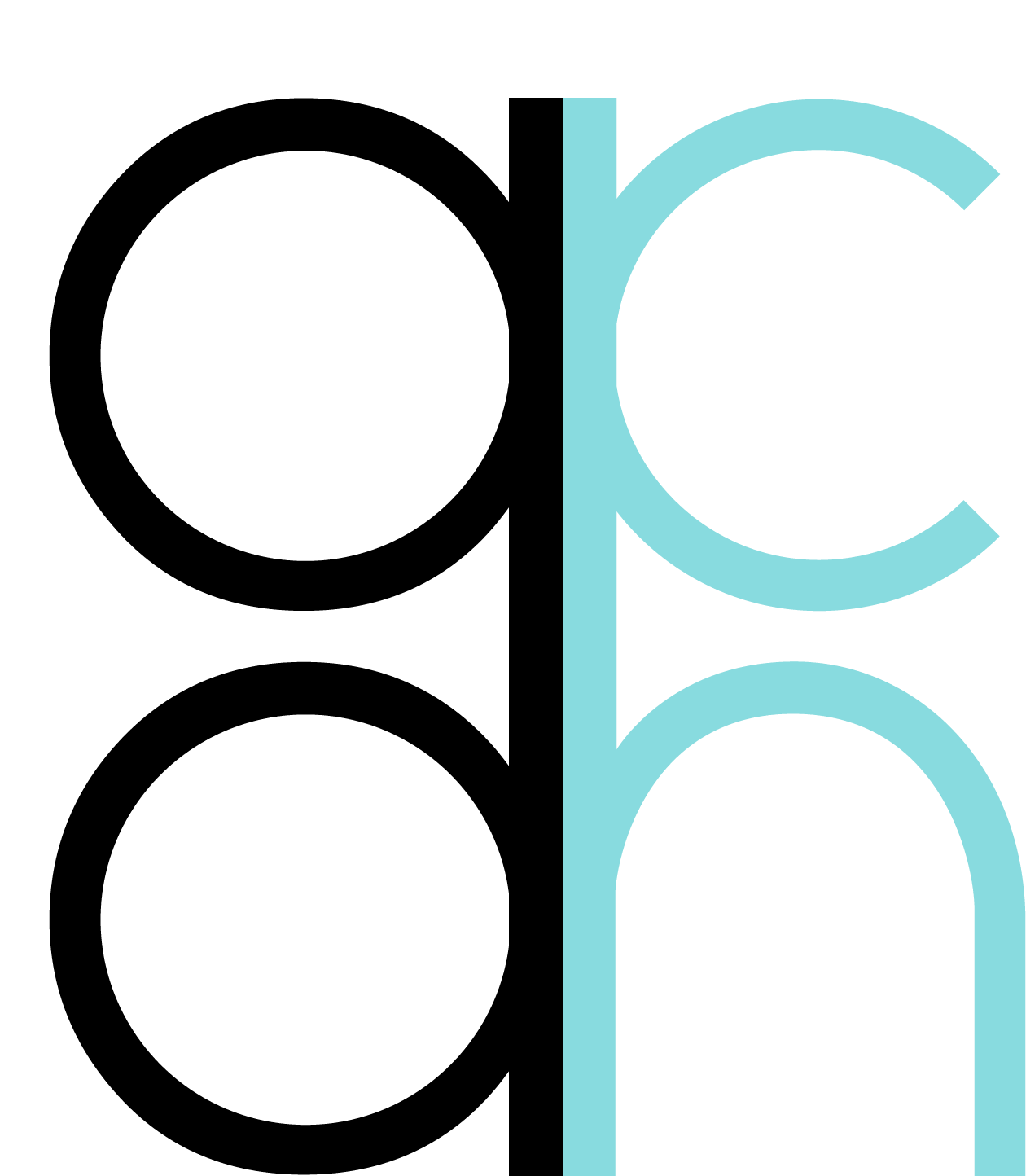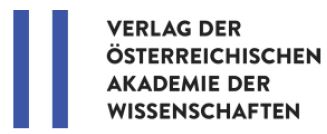Trivialmusik
Parallelausdruck zu dem in Literaturwissenschaften verwendeten Ausdruck Trivialliteratur (nach lat. trivialis = gewöhnlich, alltäglich, abgedroschen, geistlos); in der musikalischen Umgangssprache negativ besetzt und deshalb als Gattungsbezeichnung ungeeignet. Gemeint sind Abnützungserscheinungen jeglicher Musik durch Dauerpräsenz in Öffentlichkeit und Medien sowie Musikstücke von geringem Anspruch in Erfindung, Faktur und Gehalt. Solche hatten neben Kunstmusik immer existiert, wurden aber spätestens seit der 2. Hälfte des 19. Jh.s für den bürgerlichen Musikbedarf eigens produziert. Dabei stand T. in der Historie mit Kunstmusik in zweifacher Beziehung: einerseits als simplifiziertes Abbild von Kunstwerken, wobei anstelle von artifizieller Verarbeitung Stereotypien, Pseudovirtuosität sowie harmonische, melodische und rhythmische Plattitüden bei aufführungstechnischer Simplizität begegnen, u. zw. emotional mit heiterer bis sentimentaler Ausrichtung. Andererseits wurde T. als Thema, Zitat oder Idee in Kunstwerke von J. Haydn, W. A. Mozart, J. Brahms, H. Wolf, G. Mahler u. a. bis hin zur Zweiten Wiener Schule integriert, als subtiler Kunstgriff und Ausdrucksmittel innerhalb anspruchsvoller Kompositionen. Nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg unterlag T. zunehmend dem Einfluss der Populärkultur v. a. amerikanischer Herkunft, wobei ab den 1990er Jahren durch digitale Verfahrensweisen mitunter nur mehr ein Minimum an musikalischem Material benötigt und Simplifizierung zum allgemeinen Trend wurde.In der Musikwissenschaft findet sich der Begriff T. v. a. in den 1960/80er Jahren, meist in Zusammenhang mit Salonmusik des 19. und frühen 20. Jh.s., die oftmals am wahren, scheinbar marktfernen Kunstwerk gemessen und wegen Nichterfüllung dieser Kriterien stigmatisiert wurde. Dieser Ansatz resultierte aus einem Verständnis der historischen Musikwissenschaft als einer der Kunstmusik zugewandten Disziplin, welche die Totale musikalischen Geschehens, auch vergangener Epochen, erst am Ende des 20. Jh.s als Forschungsgegenstand zu erschließen begann. Zudem prägte das Subventionswesen dieser Ära die landläufige Vorstellung von freiem Schaffen, das nur in der Phase des Wirtschaftswunders der Nachkriegszeit möglich war. Die Grenzen des Begriffs T. erkennend, verschwand er aus der Fachsprache wieder, nicht aber aus dem Fachjargon. Zur Beschreibung von ausschließlich für den Markt entwickelter Musik werden in der seriösen Fachsprache neutrale Begriffe wie „Populärmusik“, „Umgangsmusik“ oder „Gebrauchsmusik“ verwendet, innerhalb derer die verschiedenen Ausprägungen und Funktionen wertfrei erfasst werden können.
Literatur
C. Dahlhaus (Hg.), Studien zur T. des 19. Jh.s 1967; H. de la Motte-Haber (Hg.), Das Triviale in Literatur, Musik u. Bildender Kunst 1972.
C. Dahlhaus (Hg.), Studien zur T. des 19. Jh.s 1967; H. de la Motte-Haber (Hg.), Das Triviale in Literatur, Musik u. Bildender Kunst 1972.
Autor*innen
Margareta Saary
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2006
Empfohlene Zitierweise
Margareta Saary,
Art. „Trivialmusik‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2006, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e507
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.