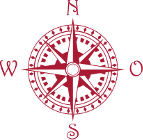Salzburger Festspiele
Repräsentatives musikalisches Festival. Im Zuge der politischen Ereignisse verlor Salzburg im frühen 19. Jh. seine frühere Bedeutung und kulturelle Geltung. Nach der Enthüllung des Mozart-Denkmals von Ludwig Schwanthaler (1842) erwachte Salzburg allmählich aus einem künstlerischen Dornröschenschlaf. Die 1841 begründete Institution Dom-Musik-Verein und Mozarteum veranstaltete erste Mozart-Feste (1842, 1852, 1856). Die Internationale Stiftung Mozarteum versuchte ab 1880 zunehmend, der Pflege und Aufführung von W. A. Mozarts Werk überregionales Interesse und internationale Aufmerksamkeit zu verschaffen. Mit acht Salzburger Mozartfesten, an jeweils mehreren Tagen im Juli bzw. August angesetzt, gelang es zwischen 1877 und 1910 allmählich, berühmte Dirigenten (K. Muck, H. Richter, G. Mahler, R. Strauss), die Wiener Philharmoniker sowie wichtige Gesangssolisten (Li. Lehmann, M. Gutheil-Schoder, Geraldine Farrar, L. Slezak, R. Mayr) für Gastspiele zu gewinnen. Dabei kam es auch zu Plänen für jährliche Mozartfestspiele in einem eigenen Operngebäude auf dem Mönchsberg (1887: H. Richter, 1890: Actions-Comité) sowie zu einem Projekt von H. Bahr und M. Reinhardt (1904), Salzburg in den vorgesehenen „Vier-Städte-Theaterverband“ einzubeziehen und während des Sommers im gepachteten Stadttheater ein kulturell aufgeschlossenes elitäres Publikum mit attraktiven Schauspiel- und Ballettproduktionen zu verwöhnen. Die Grundsteinlegung für das Gebäude der Stiftung Mozarteum (1910) ließ den Gedanken an ein eigenes Festspielhaus nur für kurze Zeit zurücktreten. Der Schriftsteller H. v. Hofmannsthal und Harry Graf Kessler schlossen sich der Initiative an. Der Salzburger Jurist F. Gehmacher und der Wiener Kritiker H. Damisch bemühten sich fortan federführend um die Festspielidee und die Errichtung einer eigenen Spielstätte (u. a. unter der Wallfahrtskirche Maria Plain). Bedenken von Mitgliedern der Internationalen Stiftung Mozarteum, die um ihre eigenen Prioritäten (z. B. Ankauf von Mozarts Geburtshaus) besorgt waren, führten 1916 zu einer Abspaltung und organisatorischen Verselbständigung des Festspielgedankens.Im Winter 1916 und Frühjahr 1917 wurden die Statuten zur Vereinsgründung vorbereitet bzw. eingereicht. M. Reinhardt verfasste seine Denkschrift zur Errichtung eines Festspielhauses in Hellbrunn, und am 14.6.1917 wurde der Verein Salzburger Festspielhaus-Gemeinde (SFG) per ministeriellen Erlass offiziell genehmigt. Im folgenden Jahr wurden Befürwortungen und Grußadressen bedeutender Persönlichkeiten zur Festspielidee eingeholt und publiziert. Reinhardt erwarb das Schloss Leopoldskron, das er für die nächsten beiden Jahrzehnte zu seinem Sommersitz wählte und zum gesellschaftlichen Ort der Begegnung aufwertete. Der ambitionierte Verein bemühte sich um das Protektorat von K. Karl I. und trat am 1.7.1918 mit der ersten Folge seiner Mitteilungen der Salzburger Festspielhausgemeinde hervor. Auf der Direktoriumssitzung vom 14.8.1918 wurde die Einrichtung eines Kunstrates für programmative Fragen erörtert, dem mit Reinhardt, F. Schalk und R. Strauss bereits wichtige Proponenten des eigentlichen Festspielkomitees angehören sollten. Reinhardt erwog mit Hofmannsthal und dessen Freund, dem damaligen Generalintendanten der k. k. Hoftheater Leopold von Andrian, die Eingliederung der künftigen F. in dessen Einflussbereich. M. Reinhardt als der vorgesehene künstlerische Leiter hätte damit seinen Spielplan mit Gastaufführungen der Hofoper und der Verpflichtung von Wiener Solisten und Orchestern bestreiten bzw. ergänzen können. Der ehrgeizige Plan scheiterte an den politischen Ereignissen (11.11. Rücktritt des Kaisers, 12.11. Ausrufung der Republik Deutschösterreich). 1919 sollte im Gefolge der neuen Staatsordnung und Regierungsform Schloss Hellbrunn mit seinen Parkanlagen in den Besitz der Stadt Salzburg gelangen, was die Standortfrage des geplanten Festspielhauses wiederbelebte. Mit E. Kerber wurde eine Persönlichkeit zum Sekretär der Festspielgemeinde bestellt, der das Festival später in hohen Funktionen (Generalsekretär, dann Direktor) bis zu seinem plötzlichen Tod (1943) leitend betreuen sollte. In wichtigen Programmschriften und Memoranden (Die S. F., F. in Salzburg, Das Salzburger Programm u. a.) warb H. v. Hofmannsthal seit seiner Festrede (Die Idee der S. F.) ab 1919 intensiv und mit kulturhistorischen Motiven für das Grundkonzept und den Standort Salzburg. Mit dem Halleiner Weihnachtsspiel in der Bearbeitung von Max Mell, das M. Reinhardt in der Franziskanerkirche zu den Festtagen 1919 inszenieren wollte, sollte auf das erste Festspieljahr eingestimmt werden. Doch aus Mangel an Nahrungsmitteln und Heizmaterial wurde das Vorhaben von den zuständigen Staatsämtern („derzeitige äußerst schwierige Versorgungslage“) abgelehnt.
Die ersten eigentlichen S. F. fanden 22.–26.8.1920 statt und umfassten vier Aufführungen von Hofmannsthals Jedermann in der Regie von M. Reinhardt auf dem Domplatz bzw. in der Univ.saula. Der große Erfolg erforderte eine weitere Vorstellung (27.8.) und führte zu einer eigenen Darbietung für die Salzburger Bevölkerung (29.8.). Das zweite Festspieljahr brachte Veranstaltungen unter dem Titel von drei verschiedenen Anbietern: Den Jedermann-Vorstellungen der Salzburger Festspielhaus-Gemeinde sollten drei Aufführungen von Mozarts Bastien und Bastienne im Naturtheater Mirabellgarten zur Seite treten, die aber infolge technischer Schwierigkeiten kurzfristig abgesagt wurden. Daneben organisierte das Mozarteum Orchester- und Kammerkonzerte, eine Serenade sowie ein Konzert mit geistlicher Musik, die später allesamt als Kategorien in das bis heute gültige Programmkonzept eingingen. Das Stadttheater (heute: Landestheater) wartete mit einem Ballettabend sowie einem Stück von Max Mell auf. Mit der großen Reitschule als alternativem Spielort des Jedermann wurde in diesem Jahr erstmals der spätere Festspielbezirk einbezogen. 1923 nahm das bereits zweieinhalbwöchige Angebot gleichsam den Idealtypus des Festivals vorweg. M. Reinhardt produzierte in der Kollegienkirche Hofmannsthals Das Salzburger große Welttheater. Im Stadttheater wurden mit Wiener Künstlern die „großen“ Mozartopern Don Giovanni, Così fan tutte, Le nozze di Figaro, Die Entführung aus dem Serail aufgeführt. Dirigenten waren die beiden Wiener Operndirektoren R. Strauss und F. Schalk, die im Mozarteum auch zwei Konzerte des Orchesters der Wiener Staatsoper leiteten. Schwierigkeiten organisatorischer und finanzieller Art, aber auch persönliche Querelen ließen 1923 in einer Sparvariante bloß vier Aufführungen von Jean-Baptiste Molières Der eingebildete Kranke (Regie M. Reinhardt) im Stadttheater zu. Und der Sommer 1924 blieb überhaupt festspielfrei. Das für die Kollegienkirche geplante Spiel Das Mirakel (Karl Vollmoeller, M: Engelbert Humperdinck) wurde auf das Folgejahr verschoben, in dem mit der Eröffnung des ersten Salzburger Festspielhauses (13.8.1925) der Weg zum internationalen kulturellen Großereignis angebahnt wurde. Nach dem ersten Umbau des Festspielhauses 1926 erfolgte 1937/38 eine große Adaption des Hauses; hierbei kam es auch zur Neuaufstellung der 1925 errichteten Orgel durch Dreher & Flamm, wobei ein Teil als Freiluftorgel (s. Abb.) konzipiert wurde.
Der immer wieder konstruktiv oder polemisch bemühte Begriff „Salzburger Dramaturgie“, bisweilen semantisch ausgedünnt und bis zur Unkenntlichkeit entstellt, geht im Prinzip auf die Memoranden H. v. Hofmannsthals zurück und wurde in Programmschriften des Regisseurs O. F. Schuh nach dem Zweiten Weltkrieg terminologisch verfestigt. Schon 1919 (Deutsche Festspiele zu Salzburg) war für Hofmannsthal die „Gründung eines Festspielhauses auf der Grenzscheide zwischen Bayern und Österreich […] symbolischer Ausdruck tiefster Tendenzen, die ein halbes Jahrtausend alt sind, zugleich Kundgebungen lebendigen, unverkümmerten Kulturzusammenhanges“. Im historischen Aufriss bedeutete das: „Der gewaltige Unterbau ist mittelalterlich, in Gluck war der Vorgipfel, in Mozart war der wahrhaftige Gipfel und das Zentrum: dramatisches Wesen und Musikwesen in eins – hohes Schauspiel und Oper, stets nur begrifflich geschieden, im Barocktheater des siebzehnten Jahrhunderts schon vereinigt, in der Tat untrennbar.“ Im Beitrag Die S. F. (1919) wies der Schriftsteller die programmatische Spaltung von Oper und Sprechtheater zurück: „denn die beiden sind im höchsten Begriff nicht voneinander zu trennen.“ Gerade am klassischen Repertoire wird der Zusammenhang deutlich: „Die Opern Mozarts v. a., auch die Glucks, Beethovens ‚Fidelio‘ […] sind dramatische Schauspiele im stärksten Sinn, das große Schauspiel aber setzt entweder eine begleitende Musik voraus […] oder es strebt dem musikalischen Wesen in sich selbst entgegen.“ Für den Regisseur Schuh, der seine Broschüre aus 1951 im Jahre 1969 mit Reaktionen auf neue Sachverhalte zum Buch ausbaute, erwies und bewährte sich das Konzept einer „Salzburger Dramaturgie“ bereits an der Konstellation von Jedermann, Don Giovanni und Prospero: „das sind drei Figuren, die mit der Idee der F. zu identifizieren wären. Wo das Spiel nicht zum Beispiel, die abstrakte Idee nicht zum Gleichnis wird, da hat die Bühne keine Mission mehr. Der Glanz einer Aufführung kommt aus den imaginativen Kräften, die sie trotz aller Gegenströmungen noch immer auszustrahlen und zu wecken vermag.“ Von Hofmannsthal übernahm Schuh die Überwindung des Klischees vom „liebenswürdigen, anmutigen, melodiösen Komponisten des Rokoko“ und – am Beispiel von Don Giovanni – seinen Ersatz durch die Beziehung zwischen der „bewegten abgründigen Seele“ des Schöpfers mit der „Dramatik der Geschehnisse“ und der „Leidenschaftlichkeit der Figuren“. In der Diktion des Dramaturgen der 1950/60er Jahre lautet das: „In den musikalischen Spiegelungen gelingt es Mozart, Dinge, Menschen und die sie bewegenden Vorgänge von verschiedenen Standorten her zu betrachten, sie zu kontrapunktieren, sie in ihren verschiedenen Bedeutungen und Auswirkungen darzustellen.“
Den Jahrzehnten der künstlerischen und autoritären Dominanz H. v. Karajans (ab 1957, verstärkt mit der Eröffnung des Neuen bzw. Großen Festspielhauses 1960 bis 1988) wird großteils das Fehlen übergreifender programmatischer Leitlinien nachgesagt. Bei der Wahl von Opern wie Don Carlos (1958, 1960, 1975–78), Macbeth (1964/65, 1984/85), Otello (1970–72) oder Falstaff (1957, 1981/82) ließe sich immerhin mit einem Konnex zu großen Stoffen und Dramen der Weltliteratur argumentieren. Die Bereicherung des musikalischen Spielplans mit Werken wie Il Trovatore (1962/63), Aida (1979/80) oder Carmen (1966/67, 1985/86) in teils eigenwilligen, jedenfalls aber exquisiten Besetzungen und mit Karajan in der Doppelrolle von Dirigent und Regisseur sind hingegen durchwegs der Vorliebe dieses Künstlers für große, auch populäre Opern mit namhaften Interpreten zu verdanken, die auch der vorbereitenden bzw. flankierenden Studioversion guten Absatz auf dem Schallplatten- bzw. CD- und Videomarkt garantierten.
Einen Vorstoß in Richtung auf kohärente Programmschienen riskierte dann der Generalsekretär F. Willnauer, als er etwa, freilich nur konzertant, 1990 einen Orpheus-Zyklus mit den Opern von Claudio Monteverdi (L’Orfeo), Ch. W. Gluck (Orfeo ed Euridice), J. Haydn (L’anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice) und E. Krenek (Orpheus und Eurydike) auf das Programm setzte. In der Ära von G. Mortier und H. Landesmann (mit Heinrich Wiesmüller und danach Helga Rabl-Stadler im Präsidentenamt) war man deutlich um eine Reform des Spielplans und eine Erweiterung sowie Profilierung des Opernrepertoires bemüht. Schon die Eröffnung der ersten Saison 1992 mit L. Janáčeks Aus einem Totenhaus war ein deutliches kulturpolitisches Signal. Als thematische Schwerpunkte des Jahrzehnts (bis 2001) lassen sich etwa ausmachen: gegensätzliche Frauenporträts (La Traviata, Lulu, Erwartung, Herzog Blaubarts Burg, 1995), Herrscherfiguren bei Mozart (Mitridate Re di Ponto, Lucio Silla, La clemenza di Tito, Die Zauberflöte, 1997), himmlisches Jerusalem und modernes Babylon (François d’Assise, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 1998), aber auch der Krieg um Troja – als Ort des Spannungsverhältnisses von Liebe und Tod (Iphigénie en Tauride, Idomeneo, Les Troyens, La belle Hélène, 2000).
Die in dieser Dekade z. T. mehrmals inszenierten großen Mozartopern erfuhren in ihrer szenischen Deutung durch Exponenten des modernen Regietheaters (Ursel und Karl-Ernst Herrmann, Johannes Schaaf, Patrice Chéreau, Achim Freyer, Luca Ronconi, Hans Neuenfels, Christoph Marthaler) unterschiedliche, sogar kontroversielle Aufnahme bei Presse und Publikum. Das gespaltene Verhältnis des Intendanten zu Werk und Persönlichkeit von R. Strauss wurde vielfach beklagt. In der Beziehung zum Schauspieldirektor Peter Stein wurden die anfänglichen Synergien (Shakespeare-Zyklus) bald von Animositäten gestört und durch Friktionen abgelöst.
Der derzeit amtierende Festspielleiter P. Ruzicka (2002–06) hat seine Programmideen mit tragenden Säulen und thematischen Inseln verglichen, die in wechselnder Anordnung und Verdichtung seine Spielpläne durchziehen: da gibt es etwa das (unterschiedlich vollendete und spielbar gemachte) Fragment(Les contes d’Hoffmann, Turandot, Der König Kandaules), Werke verfolgter bzw. exilierter Komponisten (Die tote Stadt, Die Bakchantinnen, Die Gezeichneten), das späte Werk von R. Strauss (Die Liebe der Danae, Die Ägyptische Helena), schließlich und v. a. das musikdramatische Œuvre Mozarts, das 2006 zur Gänze (mit neuen Ergänzungen bzw. „Kontrafakturen“ von Stücken wie L’oca del Cairo, Lo sposo deluso, Zaide) szenisch aufgeführt werden soll. Unter den Intendanten Mortier und Ruzicka wurde auch der wissenschaftlichen Aufbereitung der Programmschwerpunkte und der ideologisch-kritischen Sichtung der Hauptwerke Aufmerksamkeit zuteil, wovon etwa die alljährlichen Festspieldialoge und Festspielsymposien beredtes Zeugnis ablegen.
Ein kurzer Überblick über die Festspielgeschichte muss sich auf eine bescheidene Auswahl von Eckdaten, Fakten, Leitlinien, Krisen, Höhepunkten, Weichenstellungen usw. beschränken. Die späten 1920er Jahre brachten zunehmend Opern- und Schauspielaufführungen der großen Wiener Bühnen auf den sommerlichen Spielplan, was zwar ein hohes Niveau und eine funktionierende Ensemblekultur garantiert, aber das Eigenprofil der F. gefährdete, wie B. Paumgartner später resümierte. Dazu kam ein Konkurrenzkampf der großen Dirigenten (C. Krauss, B. Walter, A. Toscanini, immer wieder R. Strauss), der sowohl auf das Repertoire als auch auf die Engagements von Solisten zurückschlug. Hervorragende Orchesterleiter wie Fritz Busch und E. Kleiber konnten in Salzburg nicht dauerhaft Fuß fassen. Die in jeder Hinsicht hohen Forderungen Toscaninis nahmen die Lage der späten 1940er und der 1950er Jahre vorweg, als W. Furtwängler und H. v. Karajan um die künstlerische Vorherrschaft rangen und ihr Bleiben jeweils an anspruchsvolle Bedingungen (langfristige Verträge, Entscheidungsvollmacht) knüpften. Mit dem Anschluss Österreichs an Hitlerdeutschland (Nationalsozialismus) trat 1938 auch ein deutlicher Wechsel in Stückwahl, Ästhetik und personeller Besetzung ein. Das erst im Jahr davor eingeweihte Festspielhaus C. Holzmeisters wurde in einer Blitzaktion innenarchitektonisch verändert (Abtragung der Faistauer-Fresken im Foyer, Ersatz von Holz durch Stuckarbeiten, Beleuchtung). Die wichtigsten Dirigenten der kommenden Jahre waren neben Furtwängler und dem wiedergekehrten Krauss, der ab 1942 Generalintendant wurde, K. Böhm und H. Knappertsbusch, daneben die Italiener Vittorio Gui und Tullio Serafin. Davor waren B. Walter zwei Neuerungen mit nachhaltiger Wirkung zu verdanken: Die Aufführung der italienischen Mozartwerke (Da Ponte-Opern, Opere Serie) in Originalsprache wurde mit wenigen Ausnahmen ein frühes Markenzeichen der S. F. Seine Liederabende mit Lo. Lehmann stifteten eine Tradition, die besonders ab den 1950er Jahren zu einer tragenden Säule im Konzertgeschehen wurden (E. Schwarzkopf, I. Seefried, Ch. Ludwig, D. Fischer-Dieskau, Hermann Prey u. a.).
Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfuhren die S. F. drastische Einschränkungen. Der Sommer 1940 bot nur über zwei Wochen einen Konzertzyklus der Wiener Philharmoniker sowie zwei Serenaden. Das Programm von 1943 nannte sich Salzburger Theater- und Musiksommer. Von der Planung für 1944 blieben nach der allgemeinen Theatersperre nur noch die öffentliche Generalprobe der UA von R. Strauss’ Die Liebe der Danae (16.8.) und ein philharmonisches Konzert unter Furtwängler mit A. Bruckners 8. Symphonie (14.8.) übrig.
Eine neue, aber keineswegs unumstrittene Kulturpolitik setzte ab 1947 auf das moderne Opernschaffen mit EA.en und Auftragswerken der S. F. Auf G. v. Einems Dantons Tod folgten u. a. Der Zaubertrank (Frank Martin, 1948), Antigonae (Carl Orff, 1949), Der Raub der Lukrezia (Benjamin Britten) und Romeo und Julia (Boris Blacher, 1950). Nach weiteren UA.en (Einems Der Prozess, 1953; Irische Legende von Werner Egk, 1955; Penelope und Die Schule der Frauen, letztere eine europäische EA, von Rolf Liebermann, 1954 bzw. 1957) bewirkte der geringe Erfolg von Opern der Komponisten Samuel Barber, H. Erbse und Rudolf Wagner-Régeny (1958–61) eine Zäsur. Gerade H. v. Karajan setzte in der Folge eher auf Wiederaufführungen bereits anderswo bewährter Stücke. Auftragswerke wie Die Bassariden (H. W. Henze, 1966), Baal (F. Cerha, 1981) oder Die schwarze Maske (K. Penderecki, 1986), später in der Ära Mortier Cronaca del luogo (Luciano Berio, 1999) und L’amour de loin (Kaija Saariako, 2000) sowie unter der Intendanz von P. Ruzicka L’Upupa (H. W. Henze, 2003) blieben markante Ausnahmen vom Regelfall.
Die Salzburger EA von A. Bergs Wozzeck unter K. Böhm (1951), damals auch ein politischer Zankapfel, bedeutete eine wichtige Etappe in der Rezeption dieses Werks, das in späteren Jahrzehnten mehrmals auf dem Festspielprogramm erschien. Als ein Höhepunkt von Mortiers Spielplangestaltung gilt die Produktion von Olivier Messiaens Saint François d’Assise in der Regie von Peter Sellars (1992, 1998).
In der Debatte um die hohen Kosten von Festspielproduktionen im Vergleich mit ihrer geringen Aufführungszahl haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten Koproduktionen oder Übernahmen durch andere Bühnen als Lösung angeboten. Dazu kommt das Schlagwort „Umwegrentabilität“, das Investitionen in die Hochkultur mit den Ausgaben der Festspielgäste für Logis, Verpflegung, Kleidung und Einkäufe vergleicht und in diesem Aufwand eine Art von indirekter Subvention erkennt. Der Umbau des Festspielbezirks in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts wurde von einem großen Diskussionsprozess begleitet. Seit Sommer 2006 steht das neue „Haus für Mozart“ (s. Abb.) an der Stelle des Kleinen Festspielhauses (in der Zweitversion Clemens Holzmeisters) zur Verfügung.
Literatur
E. Fuhrich/G. Prossnitz, Die S. F. 1 (1920–1945), 1990; H. Jaklitsch, Die S. F. 3 (Verzeichnis der Werke und Künstler 1920–1990), 1990; G. Mortier/H. Landesmann et al. (Hg.), Das Neue, Ungesagte. S. F. 1992–2001, 2 Bde. 2001; S. Gallup, Die Gesch. der S. F. 1989; M. P. Steinberg, Ursprung und Ideologie der S. F. 1890–1938, 2000; P. Csobàdi/G. Gruber et al. (Hg.), [Kgr.-Ber.] „Und jedermann erwartet sich ein Fest“. Salzburg 1995, 1996; B. Huter (Hg.), Oper im Kontext. Musiktheater bei den S. F.n 2003; O. Panagl in R. Kriechbaumer (Hg.), Österr. Nationalgesch. nach 1945. Der Spiegel der Erinnerung: Die Sicht nach innen 1998; G. Allmer in Das Orgelforum Nr. 13 (2010).
E. Fuhrich/G. Prossnitz, Die S. F. 1 (1920–1945), 1990; H. Jaklitsch, Die S. F. 3 (Verzeichnis der Werke und Künstler 1920–1990), 1990; G. Mortier/H. Landesmann et al. (Hg.), Das Neue, Ungesagte. S. F. 1992–2001, 2 Bde. 2001; S. Gallup, Die Gesch. der S. F. 1989; M. P. Steinberg, Ursprung und Ideologie der S. F. 1890–1938, 2000; P. Csobàdi/G. Gruber et al. (Hg.), [Kgr.-Ber.] „Und jedermann erwartet sich ein Fest“. Salzburg 1995, 1996; B. Huter (Hg.), Oper im Kontext. Musiktheater bei den S. F.n 2003; O. Panagl in R. Kriechbaumer (Hg.), Österr. Nationalgesch. nach 1945. Der Spiegel der Erinnerung: Die Sicht nach innen 1998; G. Allmer in Das Orgelforum Nr. 13 (2010).
Autor*innen
Oswald Panagl
Letzte inhaltliche Änderung
15.10.2010
Empfohlene Zitierweise
Oswald Panagl,
Art. „Salzburger Festspiele‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.10.2010, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001e03a
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.