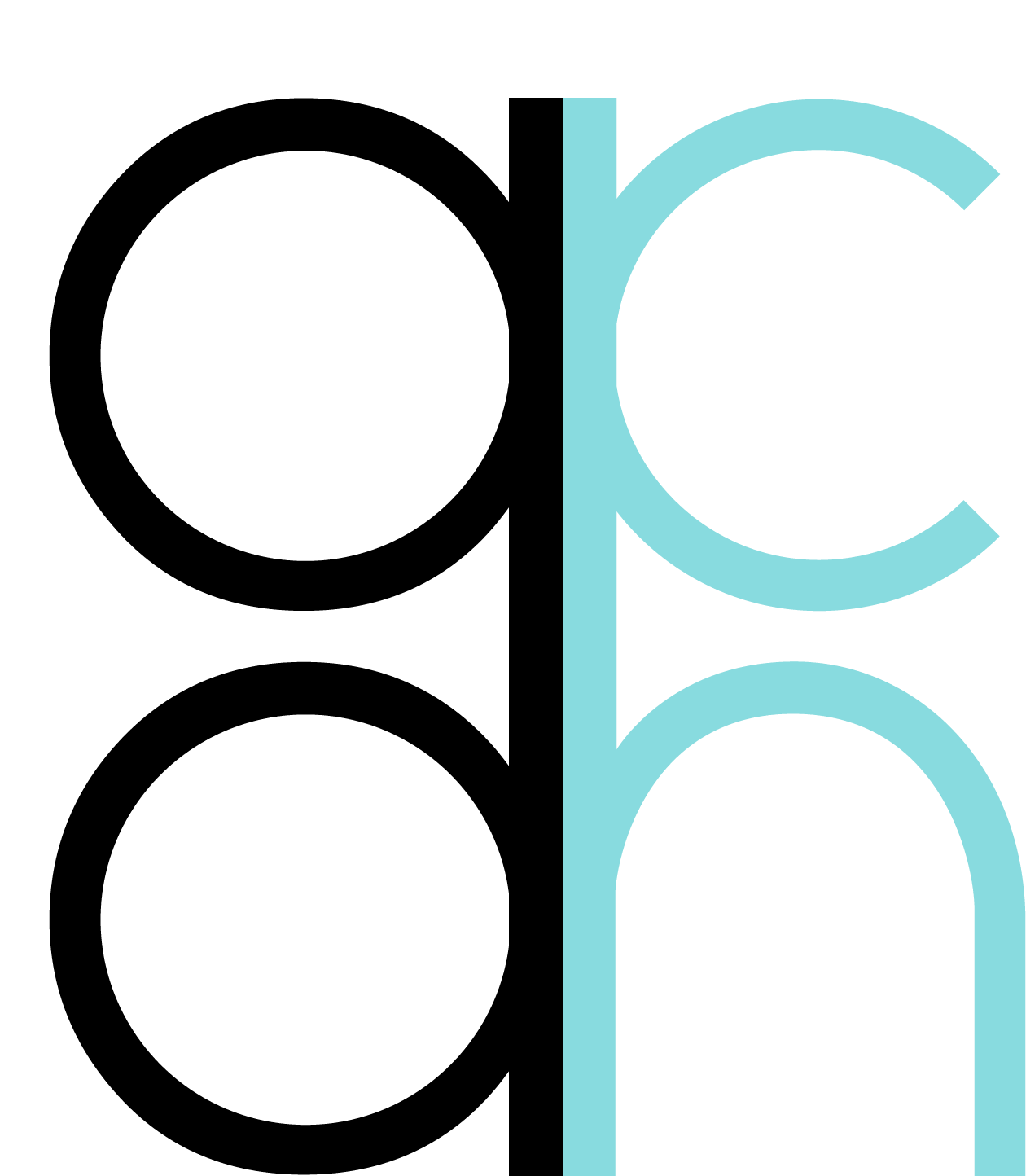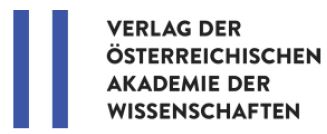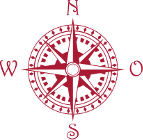Rössel-Majdan
(Rössl-Majdan, Rössel, Rössl), Familie
Karl:
* 16.4.1885 Wien,
† 4.5.1948 Wien.
Sänger (Bass).
Sohn des Musiklehrers Kurt R.-M., studierte Musikwissenschaft sowie Philosophie an der Univ. Wien und absolvierte eine Gesangausbildung. Hauptberuflich bis 1918 in der K. u. k. Armee, begann er 1919 eine Reihe von Tourneen als Konzertsänger. Engagements führten ihn nach Salzburg (1922), Reichenberg (1924/25) und an die Volksoper Wien (1925–27). Daneben unterrichtete er ab 1922 Gesang am Wiener Konservatorium Lutwak-Patonay, danach war er als Spielleiter in Saarbrücken/D tätig. 1934–48 Prof. für Gesang an der Wiener MAkad.
Ehrungen
Maria-Theresien-Orden 1918.
Maria-Theresien-Orden 1918.
Sein Sohn Karl Wilhelm Viktor: * 2.12.1916 Wien, † 6.8.2000 Wien. Kulturwissenschaftler und Anthroposoph. Studierte ab 1935 an der Univ. Wien (Dr. jur. 1939, Dr. phil. 1949, Dr. rer. pol. 1951) und arbeitete ab 1945 beim ORF (u. a. wissenschaftlicher Referent, Leiter der Abteilung für Rundfunkforschung) und in der Erwachsenenbildung (ab 1961). Er war Gründer und Präsident der Stiftung Kuratorium für künstlerische und heilende Pädagogik, 16 Jahre Vorsitzender der Gewerkschaft Kunst, Medien und freie Berufe (KMSfB), Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft für Kunst und Wissenschaft in Österreich, Vizepräsident der Österreichischen Künstlerunion und Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft in Österreich.
Ehrungen
Medaille des österr. Widerstandes; Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien; Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
Medaille des österr. Widerstandes; Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien; Großes Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.
Schriften
Rundfunk und Kulturpolitik 1962; Vom Wunder der menschlichen Stimme 1975; Hörspiele; zahlreiche Artikeln in Ztg.en u. Zss.
Rundfunk und Kulturpolitik 1962; Vom Wunder der menschlichen Stimme 1975; Hörspiele; zahlreiche Artikeln in Ztg.en u. Zss.
Dessen Frau Hilde (Hildegard): * 30.1.1921 Moosbierbaum/NÖ, † 15.12.2010 Wien. Sängerin (Alt). War Schülerin ihres Schwiegervaters an der MAkad. Wien (1945–49), 1931 debütierte sie als Solosängerin-Elevin an der Wiener Staatsoper. 1951 gelang ihr mit dem „Urlicht" in G. Mahlers 2. Symphonie unter Otto Klemperer der Durchbruch zu einer internationalen Karriere als Lied-, Oratorium- und Opernsängerin, im selben Jahr ging sie einen Vertrag mit der Wiener Staatsoper ein (ab 1955 Ensemblemitglied); ab 1954 trat sie auch bei den Salzburger Festspielen auf. 1966 begann R.-M. ihre pädagogische Karriere mit einem Lehrauftrag an der MAkad. in Graz, wo sie 1970 zur a.o. Prof. für Lied und Oratorium ernannt wurde. 1972 übernahm sie eine Professur für Stimmbildung an der MHsch. Wien (1976 o. Prof., 1991 emeritiert).
Ehrungen
Kammersängerin 1962; Österr. Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse 1982.
Kammersängerin 1962; Österr. Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse 1982.
Literatur
DBEM 2003; K-R 1997; [Kat.] 100 Jahre Wr. Oper 1969, 219; Riemann 1961 u. 1975; Czeike 6 (2004); Who is who in Öst. 1997; Ulrich 1997; https://de.wikipedia.org/ (10/2017); Akten Archiv MUniv. Wien.
DBEM 2003; K-R 1997; [Kat.] 100 Jahre Wr. Oper 1969, 219; Riemann 1961 u. 1975; Czeike 6 (2004); Who is who in Öst. 1997; Ulrich 1997; https://de.wikipedia.org/ (10/2017); Akten Archiv MUniv. Wien.
Autor*innen
Lynne Heller
Christian Fastl
Christian Fastl
Letzte inhaltliche Änderung
17.10.2017
Empfohlene Zitierweise
Lynne Heller/Christian Fastl,
Art. „Rössel-Majdan (Rössl-Majdan, Rössel, Rössl), Familie‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
17.10.2017, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001df80
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.