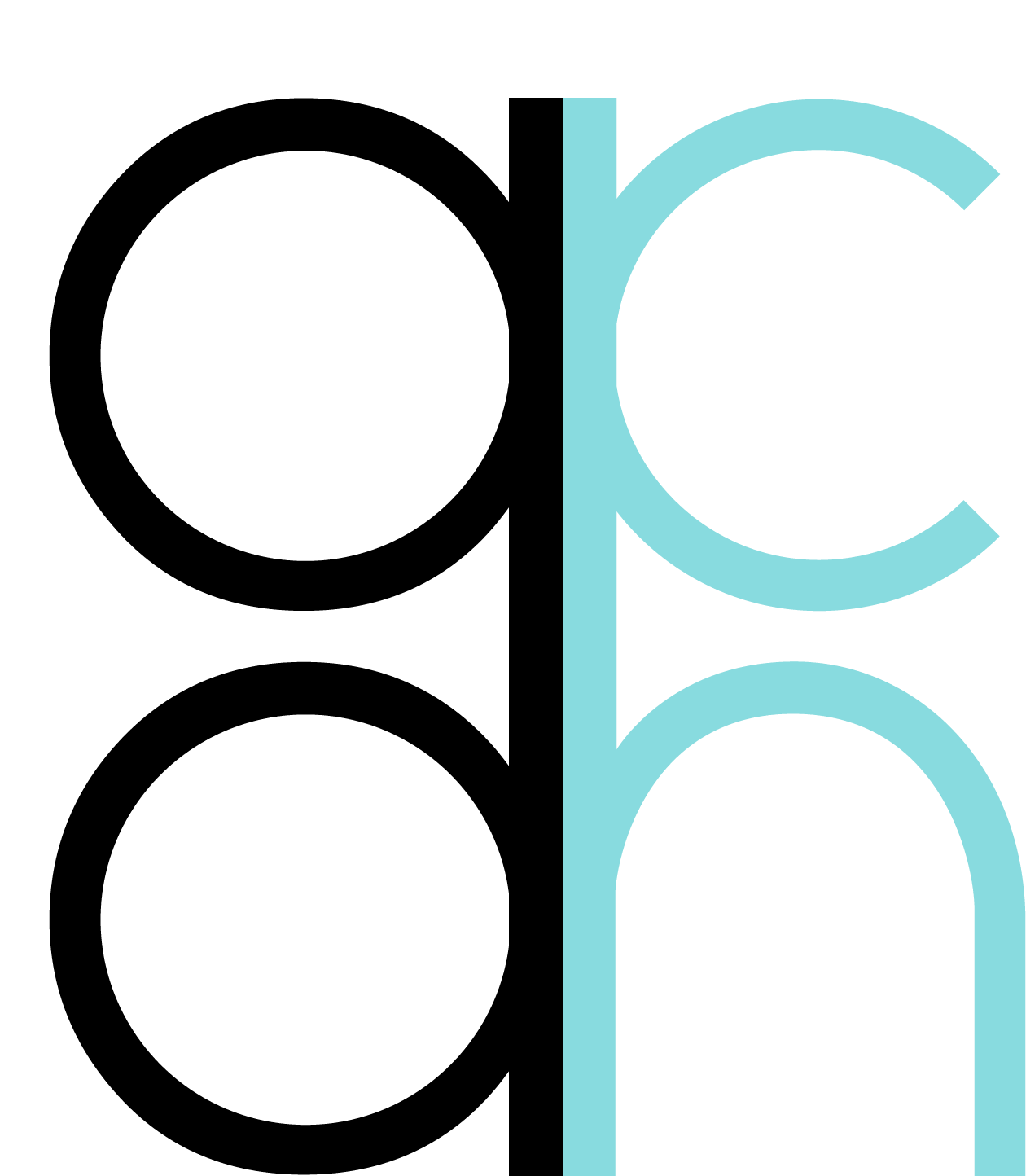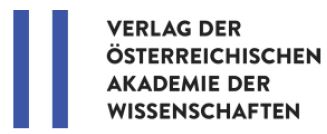Reihe/Reihentechnik
Vorformung des Materials einer Komposition unter spezifischer Anordnung der zwölf Töne des gleichschwebend temperierten Systems. Problemgeschichtlich bildet die Reihentechnik eine Folgeerscheinung der kompositorischen Notwendigkeit, nach der Aufgabe des Dur-Moll-tonalen Regelsystems alternative Formbildungsverfahren zu entwickeln. In der europäischen Krise der Tonalität um 1910 können nach ersten Versuchen bei Alexandr Skrjabin voneinander unabhängige Experimente verschiedener russischer Komponisten mit Zwölftongruppen beobachtet werden (Nikolai Roslawets, Arthur Lourié, Nikolas Obuchow). Systematisierungsansätze entstanden aber v. a. im Österreich der Jahre gegen 1920: Neben Versuchen von F. H. Klein entwickelte J. M. Hauer ein Reihenverfahren, das zwei sechstönige Gruppen aus dem chromatischen Total bildet, die innerhalb einer Komposition in jeweils 44 möglichen Kombinationen (den sog. Tropen) erscheinen können. Hauers Verfahren der „Tropen“-Ableitung unterliegt dabei weniger stark Entscheidungen des Komponisten als strukturbedingt „objektiven“, mystisch-esoterisch hergeleiteten Kriterien. Sein Schüler O. Steinbauer führte die Ideen Hauers als „Lehre“ von „Klangreihen“ fort, die wahlweise vor oder erst während des Komponierens festgelegt werden können.Breitere Wirksamkeit war A. Schönbergs Methode der „Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ beschieden, die seit 1921 Eingang in sein künstlerisches Werk fand (zuerst mit den Klavierstücken op. 23 und der Serenade op. 24). Schönbergs Technik ordnet eine für die jeweilige Komposition verbindliche Aufeinanderfolge der zwölf Töne des gleichschwebend temperierten Systems, für die vier verschiedene Erscheinungsformen vorausgesetzt werden: die Original- (oder Grund-) Gestalt, der Krebs, die Umkehrung und der Krebs der Umkehrung. Umwandlungen der Originalgestalt, die auch als deren horizontale oder vertikale Spiegelung bezeichnet werden, verändern dabei den Tonverlauf, jedoch nicht die einmal gewählten Intervallproportionen. Jede Erscheinungsform einer Zwölftonreihe ist elfmal transponierbar. Somit ergeben sich für eine reihengebundene Komposition 48 Reihenformen, die mit den zwölf verfügbaren Tönen theoretisch 479.001.600 verschiedene Grundgestalten ermöglichen. Man hat Schönbergs Reihentechnik entstehungsgeschichtlich auf die konsequenten Erweiterungen der motivisch-thematischen Arbeit und der Dur-Moll-tonalen Harmonik im späteren 19. Jh. zurückgeführt (Réti). Insbesondere J. S. Bachs und L. v. Beethovens Variationstechnik sowie J. Brahms’ motivischen Ableitungsverfahren ganzer Werkzusammenhänge aus einzelnen Intervallzellen sprachen die Komponisten der Zweiten „Wiener Schule“ selbst eine geschichtliche Vorläuferfunktion zu: nicht zuletzt freilich, um das Verfahren als historische „Notwendigkeit“ zu legitimieren (Schönberg, A. Webern).
Dass Schönberg die Reihentechnik nie unterrichtete, hatte eine ausgesprochen eigenständige Aneignung durch seine Schüler zur Folge: Bei A. Webern zeigt sich die Neigung zu symmetrischen Reihenkonstruktionen, aus denen gewichtige strukturelle Konsequenzen für die Gesamtstruktur eines Werkes erwachsen. Es ergeben sich etwa um eine Intervallachse gegliederte Reihen, die identisch mit ihrer Krebsgestalt (in der Symphonie op. 21) oder ihrer Krebsumkehrung (in den Variationen op. 30) sind. Alban Berg bevorzugt dagegen Reihen, die durch motivische Gruppenbildung und die Zerlegung Dur-Moll-tonaler Akkordbildungen ausgezeichnet sind. Während Webern die Reihenintervallik als strukturellen Keim der Gesamtform eines Stückes versteht, nutzt Berg (wie auch Schönberg selbst) die Zwölftontechnik als Grundlage für eine traditionelle Motiv- und Themenbildung. Bei Berg findet sich auch die Arbeit mit Reihen, die deutlich mehr als zwölf Töne besitzen oder mit All-Intervall-Reihen, in denen neben den zwölf Tönen alle elf im temperierten System möglichen Intervalle berücksichtigt sind (Lyrische Suite).
Die nächste Generation der „Wiener Schule“ (mit Ludwig Zenk, L. Spinner, H. E. Apostel, H. Jelinek u. a.) setzt die Erweiterung reihentechnischer Möglichkeiten fort. Die Zwölftontechnik wirkt zugleich über den Kreis um Schönberg hinaus und regt zahlreiche Komponisten (wie Luigi Dallapiccola, Frank Martin oder den älteren Igor Strawinsky) zu persönlich gefärbten Neuinterpretationen an.
Einen bedeutenden Entwicklungsschritt setzt E. Krenek in den 1940er Jahren: Er veränderte Abschnitte aus einer Reihe (wie etwa Hexachorde) durch immanente Rotationsverfahren und versuchte so, eine neue Art der Modalität in Anknüpfung an die Musik des 15. Jh.s zu begründen: z. B. in der Dritten Klaviersonate oder dem Chorwerk Lamentatio Jeremiae Prophetae op. 93. Die Entwicklung nicht veränderbarer Modi, die neben der Tonhöhe auch den Rhythmus einer Komposition determinieren (um 1950 bei Olivier Messiaen), haben die Entstehung einer seriellen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg maßgeblich gefördert: Diese weitete das Reihenprinzip von der Tonhöhe auf die Parameter Dauer, Dynamik, Klangfarbe und Artikulation aus (prominent bei Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen).
Hervorzuheben ist der im weitesten Sinne musikpolitische Symbolwert der rasch zum Schlagwort ideologisierten Reihentechnik, die im „Dritten Reich“ als „entartet“ verfemt war (Nationalsozialismus), dagegen in den 1950er Jahren das zeitgemäße Bekenntnis zu einer strikten Autonomieästhetik unterstrich. In Absetzung gegenüber den seriellen Bemühungen der mitteleuropäischen Avantgarde, die sich v. a. an A. Weberns Anwendung der Reihentechnik ausrichtete, knüpften österreichische Zwölftonkompositionen nach dem Krieg vorzugsweise an die expressive Klangsprache A. Bergs an. Dem dodekaphonen Erbe der „Wiener Schule“ verpflichtet zeigten sich noch in jüngerer Zeit Komponisten wie R. Bischof, E. Hartzell oder N. Fheodoroff. Einen freieren Umgang mit der Reihentechnik auch unter der Einwirkung serieller Erfahrungen pflegten – freilich z. T. nur episodenhaft – K. Schiske, R. Schollum, H. Eder, E. Urbanner, F. Cerha u. a.
Literatur
E. Stein in Der Anbruch 6 (1924); A. Schönberg in ders., Stil und Gedanke 1976, 72–96; J. Rufer, Die Komposition mit zwölf Tönen 1952; A. Webern, Der Weg zur neuen Musik, hg. v. W. Reich 1960; M. Schmidt, Theorie und Praxis der Zwölftontechnik 1998; M. Sichardt, Zur Entstehung der Zwölftontechnik 1990; G. Scholz (Hg.), Dodekaphonie in Österreich 1988; H. U. Götte, Die Kompositionstechniken J. M. Hauers 1989; R. Réti, The Thematic Process in Music 1961.
E. Stein in Der Anbruch 6 (1924); A. Schönberg in ders., Stil und Gedanke 1976, 72–96; J. Rufer, Die Komposition mit zwölf Tönen 1952; A. Webern, Der Weg zur neuen Musik, hg. v. W. Reich 1960; M. Schmidt, Theorie und Praxis der Zwölftontechnik 1998; M. Sichardt, Zur Entstehung der Zwölftontechnik 1990; G. Scholz (Hg.), Dodekaphonie in Österreich 1988; H. U. Götte, Die Kompositionstechniken J. M. Hauers 1989; R. Réti, The Thematic Process in Music 1961.
Autor*innen
Matthias Schmidt
Letzte inhaltliche Änderung
15.5.2005
Empfohlene Zitierweise
Matthias Schmidt,
Art. „Reihe/Reihentechnik‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
15.5.2005, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001dec3
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.