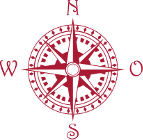Notation
Musik aufzuschreiben, um sie festzuhalten, anderen mitzuteilen oder reproduzieren zu können, ist für eine musikalische Kultur keine grundsätzliche Voraussetzung. Für die europäische Musik aber war die Schrift eine wesentliche Bedingung ihrer Entwicklung. Eine kunstvolle Mehrstimmigkeit konnte sich nur mit Hilfe der N. und der damit gegebenen Möglichkeit der theoretischen Erörterung, der Erweiterung und Bearbeitung des Notierten entfalten. Das Bemühen, Hörphänomene in graphische Symbole umzusetzen, begleitete die Musik von frühester Zeit an. Als älteste Musiknotation gelten die sog. Hurritischen Hymnen (ca. 1350 v. Chr.) aus der antiken Stadt Ugarit (heute Syrien). Die Tontafeln enthalten insgesamt 35 Musikstücke für Saiteninstrumente und (wahrscheinlich) Gesang im mesopotamischen Tonsystem, daneben auch Angaben zu Komponisten und Schreibern. Zu den ältesten Schriftzeichen gehören darüber hinaus die Buchstabenschriften der griechischen Antike sowie graphische Symbole in Texten aus den ersten nachchristlichen Jh.en (wie in den Schriftrollen vom Toten Meer), die als „prosodische Zeichen“ den kantillierenden Vortrag geistlicher Texte („Ekphonesis“) regeln sollten. Seit dem Mittelalter wurden verschiedene Schriftsysteme entwickelt, welche die Musikentwicklung begleiteten und zur Ausformung der Notenschrift führten, die heute weltweit als das wichtigste der musikalischen Schriftsysteme anerkannt ist. In diesem, zumal als Partitur, das mit seiner senkrechten Tonhöhen-Achse und der waagrechten Zeit-Achse ein Koordinatensystem bildet, kann der zweidimensionale Verlauf der Musik im Tonraum und in der Zeit sehr anschaulich dargestellt werden (s. Abb. 1).Mit der Einbeziehung außereuropäischer Musik-N.en, der neuen Erkenntnissen der Physiologie und Psychologie des Hörens (Musikpsychologie) sowie der Informationstheorie wurden in den letzten Jahrzehnten die Kenntnisse um die N. von Musik von einer „N.skunde“ zu einer umfassenden Musik-Graphik erweitert, die eine systematische Erforschung und Klassifizierung aller Schriftsysteme und des verwendeten Zeichenmaterials (Worte, Silben, Buchstaben, Ziffern, Neumen, Notenzeichen) zum Ziel hat. Da in einem Prozess der Umsetzung von lebendiger Musik in bewegungslose graphische Symbole niemals die Gesamtheit der musikalischen Vorgänge berücksichtigt werden kann, ist jedes Schriftsystem daraufhin zu untersuchen, in welcher Weise Musik und N. einander entsprechen, was die Niederschrift an Einzelheiten der Musik berücksichtigt und was nicht, welche Absichten der schriftlichen Fixierung zugrunde liegen, welche musiktheoretischen und aufführungspraktischen Voraussetzungen. Die Musik-Graphik untersucht die praktische Anwendung aller Musikschriften und ihre Rückwirkung auf Produktion und Rezeption von Musik. Da die Musikwissenschaft in vielen Bereichen auf notierte Musik (im Original oder Übertragungen) angewiesen ist, bildet die Musik-Graphik einen wesentlichen Teil der praktischen Forschungsarbeit.
Die Geschichte der abendländischen Notenschrift ist vielschichtig und von inneren und äußeren Bedingungen geprägt. Ihre Entwicklung wird durch Fortschritte der Satztechnik und dem Streben nach neuen musikalischen Ausdrucksbereichen vorangetrieben, Möglichkeiten eines neuen Schriftsystems wiederum geben neue Anregungen für die Komposition. In diesem wechselseitigen Prozess spielen auch technische Ursachen (z. B. Schreibwerkzeug) und gesellschaftliche Faktoren (z. B. Musikunterricht) mit hinein.
Obwohl ein großer Teil der älteren Musik heute in Notenschrift übertragen ist und in Neuausgaben vorliegt, ist die Auseinandersetzung mit den historischen Schriften immer noch von großer Bedeutung, da nur die Original-N. den ursprünglichen Bezug zur Musikpraxis der Zeit erkennen lässt, wenn auch die Niederschrift mancher Werke erst lange nach ihrer Entstehung erfolgt ist (wie z. B. der liturgischen Gesänge der christlichen Kirchen oder der einstimmigen weltlichen Liedkunst des Mittelalters). Die engen Zusammenhänge zwischen Schrift und musikalischer Vorstellung sind nur aus der Original-N. zu erkennen. Studien zur musikalischen Paläographie, der Wissenschaft von den alten Schriften, bilden daher die Grundlage zur Erforschung der Musikgeschichte.
Die Entwicklung der Notenschrift geht von den unterschiedlichen Anforderungen aus, die vokales und instrumentales Musizieren stellen: Das vokale Musizieren ist an den zu singenden Text gebunden, Vokalschriften verstehen sich vorerst als Interpretationsanweisungen für die Wiedergabe des Textes. Das Instrumentalspiel braucht Anleitungen zur Ausführung: Saitenangaben, Fingersätze, spieltechnische Hinweise bilden die Grundlage von Instrumentalschriften. Die beiden Schrifttypen werden nebeneinander benutzt, um sich schließlich in der Notenschrift zu vereinen.
Die Griechische Musik-N.
Im antiken Griechenland waren zwei Schriftsysteme in Gebrauch, von denen das eine (nach Alypios, um 350 n. Chr.) für die „Lexis“ (Sprache), das andere für die „Krousis“ (Saitenspiel) bestimmt war. Sie werden heute „Vokal-N.“ und „Instrumental-N.“ genannt. Beide Systeme verwenden Buchstaben zur Bezeichnung der Tonhöhen: die Instrumental-N. Zeichen eines archaischen (des altdorischen oder phönikischen) Alphabets, die gedreht und gewendet wurden und dadurch andere Tonstufen bezeichneten, die Vokal-N. die griechischen (ionischen) Großbuchstaben in ihrer Normalform. Beiden Systemen liegt das gleiche Tonsystem zugrunde, dessen Terminologie („Hypate“ – die unterste (Saite), „Lichanos“ – der Zeigefinger, „Trite“ – die dritte usw.) auf eine Herkunft aus der Instrumentalpraxis schließen lässt (s. Abb. 2).
Byzantinische N. – Lateinische Neumen
Die beiden großen Schriftsysteme zur N. der einstimmigen liturgischen Gesänge der christlichen Kirche unterscheiden sich durch Sprache (Koiné, die spätgriechische Umgangssprache in der Ostkirche (Byzantinische Musik), Kirchenlatein in der römischen Liturgie) und durch die Verwendung unterschiedlicher Zeichen, deren Ursprung auf gemeinsame Wurzeln zurückgeht wie die Prosodie und die Cheironomie, die Kunst, eine Sängergruppe mit Handzeichen zu leiten. In beiden Schriftsystemen jedoch haben die Zeichen seit den ersten erhaltenen Schriftdenkmälern (9. Jh.) eher den Charakter von Tonfiguren oder Vortragshinweisen. Sowohl die frühbyzantinischen Zeichen als auch die lateinischen linienlosen Neumen sind „adiastematisch“ (diástema = Intervall), sie geben weder Tonhöhen noch Intervalle an. Ihre genaue Bedeutung zu erforschen, ist Aufgabe der Semiologie, der „Lehre von den Zeichen“. Mit dem Anwachsen des Gesangsrepertoires ergab sich die Notwendigkeit einer genaueren Fixierung der Tonhöhen. In der Schrift der Ostkirche erhielten die bereits verwendeten Zeichen seit dem 12. Jh. („mittelbyzantinische Schrift“) genauere Intervallbedeutung. Auf eine genaue Angabe des Vortrags wird jedoch zunehmend größerer Wert gelegt, und es werden neue Vortragszeichen eingefügt, bis das System („spätbyzantinische Schrift“) unübersichtlich und im 19. Jh. zur „neugriechischen Schrift“ reformiert wurde, die heute in der Ostkirche noch verwendet wird. In Anlehnung an die byzantinische Schrift entstanden in den von Konstantinopel aus missionierten slawischen Gebieten weitere ähnliche Schriften wie die bulgarischen Neumen, die Kondakarien-N., die russische Krjuki-N. u. a.
In der lateinischen Kirche wurden im 9. Jh. die ersten Neumen entwickelt und gegen Ende des 10. Jh.s Notenlinien eingeführt. In das Liniensystem wurden die Neumenzeichen gesetzt, deren Tonhöhen damit genau angezeigt werden konnten. Obwohl die lateinischen Neumen (im Gegensatz zu den byzantinischen Zeichen) bereits die Tendenz der Diastemie in sich trugen, d. h. ein höherer Ton oft auch räumlich höher geschrieben wurde, setzte sich die neue Schreibweise nur schrittweise durch. Auch damit war eine endgültige Vereinheitlichung der Neumenschrift noch nicht erreicht, zu groß waren die regionalen Unterschiede, die zwischen den Neumentypen in den verschiedenen Liturgien und durch die führenden Schreibschulen (Skriptorien) der großen Klöster entstanden waren (Laon-Metz/F, St. Gallen/CH, Monte Cassino/I, Toledo/E u. a.). Die Vereinheitlichung der Schrift ging im 11. Jh. von Nordfrankreich aus: die Schreibfeder wurde breit zugeschnitten, aus dem einfachen Punkt wurde ein Quadrat. Die neue quadratische Form der Notenzeichen verdrängte langsam alle Neumenformen und wurde zum wichtigsten Zeichen der „römische Choral-N.“; die neue Quadratnote erwies sich auch für die N. der mehrstimmigen Musik und somit für die weitere Entwicklung der Notenschrift als zukunftweisend.
Bis zur Einführung der Notenlinie gab es mehrere Versuche, die Unsicherheit in den Tonhöhenangaben der Neumen auszugleichen. Dazu wurden v. a. Buchstaben herangezogen, wie sie als Bezeichnung von Tonstufen schon in der griechischen Antike benutzt wurden. Die beiden Buchstabenreihen des Boethius (6. Jh.) dienten ursprünglich zur Bezeichnung der Teilungspunkte der Saite auf dem Monochord, die Odonischen Buchstaben (10. Jh.) sind die heute noch als Tonnamen gebrauchten Buchstaben von a bis g (h). Eine Sonderstellung nimmt die Dasia-N. ein, die Elemente aus der griechischen N. und aus der Alchemie zu einem Zeichensystem verbindet, das für die erste überlieferte N. mehrstimmiger Musik (Musica enchiriadis, 2. Hälfte des 9. Jh.s) verwendet wurde.
Modal-N.
Seit dem 12. Jh. sind die mehrstimmigen Kompositionen wie die drei- und vierstimmigen Notre Dame-Organa (um 1200) mit Quadratnoten auf Linien notiert und in ihrer Tonhöhe eindeutig lesbar. Das neue Problem für die N. war die Fixierung der Tondauern. In der Musizierpraxis wurde der rhythmische Ablauf vom metrischen Prinzip der Folge von Längen und Kürzen bestimmt, die zu einfachen rhythmischen Modellen („Modi“) geordnet wurden. Der Theoretiker Johannes de Garlandia hat um 1250 sechs solcher Modi angeführt:
1. Modus: Lang-kurz, Longa-Brevis (L-B), 2. B-L, 3. L-B-B, 4. B-B-L, 5. B-B-B, 6. L-L-L.
Da die Schrift noch keine Zeichen für Längen oder Kürzen kannte, waren die Modi nur aus der Anordnung und Gruppierung der Ligaturen, also der aus der Choral-N. übernommen Schreibweise von zwei oder mehreren Noten in einem Zeichen, zu erkennen (s. Abb. 3).
Nach verschiedenen sog. schwarzen, zunächst unmensurierten, dann mensurierten N.en brachte die sog. weiße Mensural-N. ab ca. 1430 eine Vereinfachung des Schriftbildes. Die Zeichen konnten nicht mehr mit einem einzigen Federstrich geschrieben werden und ein „Ausmalen“ der Zeichen war nicht möglich, da sie in dem qualitativ noch schlechten Papier, das das bisher verwendete Pergament zu verdrängen begann, durchschlug. Von den größeren Werten wurden daher nur noch die Umrisse geschrieben, die Notenzeichen wurden hohl oder „weiß“. Für bestimmte Instrumente wurden eigene Schriftsysteme entwickelt (z. B. Lautentabulatur).
Tabulaturen
Der im 16.–18. Jh. verwendete Begriff „Tabulatur“ für die N. von Instrumentalmusik auf einer Tafel oder auf einem Blatt stand der vielfach geübten Praxis gegenüber, Instrumentalmusik zu improvisieren oder nach dem Gehör zu spielen. „Tabulatur“ konnte aber auch das Zusammenfassen der Einzelstimmen eines in Stimmbüchern notierten Werkes auf einem Blatt bedeuten, also die Einrichtung oder „Intabulierung“ eines polyphonen Werkes für ein Akkordinstrument. Die Einführung eines Taktstriches (oder zumindest einer deutlichen Gruppierung gleicher Notenwerte) bedeutete eine große Vereinfachung für das praktische Musizieren: perfekte Mensuren und Ligaturen und damit viele N.sregeln wurden überflüssig.
Musik für Tasteninstrumente wurde in Italien, Frankreich, England und in den Niederlanden auf zwei Liniensystemen (für die rechte und linke Hand) mit unterschiedlicher Anzahl der Linien notiert. In Deutschland wurde vorerst ein Liniensystem für die Oberstimme verwendet, die Unterstimmen in Buchstaben darunter geschrieben (Ältere deutsche Orgeltabulatur). Seit etwa 1570 wird aus drucktechnischen Gründen auch die Oberstimme in Buchstaben notiert (Neuere deutsche Orgeltabulatur).
Für das Spiel auf Lauteninstrumenten war es einfacher, nur die Griffe niederzuschreiben. Von den regional unterschiedlichen Schriftsystemen blieben die deutsche, spanische, italienische und Lautentabulatur bis etwa 1600, das französische System bis 1800 in Gebrauch. Für Unterrichtszwecke wurden Tabulaturen auch für Streich- und Blasinstrumente entwickelt.
Die heute verwendete Notenschrift ist eine Weiterentwicklung der Mensural-N.: Die eckigen Noten wurden zu runden Formen abgeschliffen, aus der Klaviertabulatur wurden der Taktstrich und damit alle Vereinfachungen der N. übernommen. Durch das Übereinanderstellen mehrerer Liniensysteme entstand die Partitur für mehrstimmige Vokal- oder Instrumentalwerke.
Notenschriftreformen wurden schon seit dem 17. Jh. immer wieder gefordert, v. a. um 1900, als das Notenbild durch die zunehmende Verwendung von Versetzungszeichen immer unübersichtlicher wurde. Ziel der Reformen war es v. a., die Anzahl der Notenzeichen auf 12 zu verringern (entsprechend den 12 Tasten des Klaviers innerhalb einer Oktave) und die Ähnlichkeit von Oktavtönen auch im Notenbild anschaulich darzustellen (z. B. J. M. Hauer, O. Steinbauer, L. Edlmann, K. Laker, W. J. Lanz). Bis jetzt ist noch keiner Reformbestrebung ein entscheidender Durchbruch gelungen, da Notendruck und Computerprogramme an der traditionellen Notenschrift festhalten. Einer der kuriosesten Reformvorschläge ist die „Homographie“ der Lady Scott (Pseud.), 1831 (s. Abb. 4).
Anderer Art und anderen Bedürfnissen entsprechend ist die sog. Graphische N. Es ist dies ein nicht ganz korrekter Terminus für eine neue Aufzeichnungsart der Neuen Musik nach 1950. Der Komponist verzichtet auf genaue Ausführungs-Vorschriften, vielmehr wird eine unbestimmte N.sweise oder eine Zeichnung als Anregung und als Vorlage verstanden, der Ausführung eine bestimmte Richtung zu geben oder musikalische Aktionen anzuregen, wobei die Kreativität der Ausführenden mit einbezogen werden sollte. Jedes Musikwerk bedarf daher einer speziellen Form der Niederschrift und besonderer Zeichen und damit auch ausführlicher Erklärungen des Komponisten. Einige wenige Zeichen aus diesen N.spraktiken haben sich allgemein durchgesetzt (Cluster, Gleittöne und Gleitklänge, höchste und tiefste Töne u. a.).
Literatur
(chron.) J. Wolf, Hb. der N.skunde, 2 Bde. 1913 u. 1919; C. Parrish, The N. of Medieval Music 1959; W. Apel, Die N. der polyphonen Musik 900–1600, 1962; C. Dahlhaus (Hg.), N. Neuer Musik 1965; E. Karkoschka, Das Schriftbild der Neuen Musik 1966; H. Besseler/P. Gülke, Schriftbild der mehrstimmigen Musik 1973; B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik 1975; C. Floros, Einführung in die Neumenkunde 1980; R. Gardner, Source Book of Proposed Music N. Reforms 1987; O. Elschek, Die Musikforschung der Gegenwart, ihre Systematik, Theorie und Entwicklung 1992; MGG 7 (1997); K. Schnürl in [Fs.] E. Würzl 1996 u. [Fs.] R. Flotzinger 1999; K. Schnürl, 2000 Jahre europäische Musikschriften 2000; J. Rahn in aamw Journal 1/1 (2011).
(chron.) J. Wolf, Hb. der N.skunde, 2 Bde. 1913 u. 1919; C. Parrish, The N. of Medieval Music 1959; W. Apel, Die N. der polyphonen Musik 900–1600, 1962; C. Dahlhaus (Hg.), N. Neuer Musik 1965; E. Karkoschka, Das Schriftbild der Neuen Musik 1966; H. Besseler/P. Gülke, Schriftbild der mehrstimmigen Musik 1973; B. Stäblein, Schriftbild der einstimmigen Musik 1975; C. Floros, Einführung in die Neumenkunde 1980; R. Gardner, Source Book of Proposed Music N. Reforms 1987; O. Elschek, Die Musikforschung der Gegenwart, ihre Systematik, Theorie und Entwicklung 1992; MGG 7 (1997); K. Schnürl in [Fs.] E. Würzl 1996 u. [Fs.] R. Flotzinger 1999; K. Schnürl, 2000 Jahre europäische Musikschriften 2000; J. Rahn in aamw Journal 1/1 (2011).
Autor*innen
Karl Schnürl
Letzte inhaltliche Änderung
9.9.2021
Empfohlene Zitierweise
Karl Schnürl,
Art. „Notation‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
9.9.2021, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001db65
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.