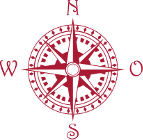Kirchenmusik, katholische
Ein Oberbegriff mit einer komplizierten Entstehungs- und Verwendungsgeschichte, welcher mehrere Erscheinungsformen der Musik von christlichen Kirchen benennt. Folgendes ist zu unterscheiden:a) Liturgische Musik ist integraler Bestandteil des Gottesdienstes (Liturgie) als Vokal- und Instrumentalmusik für Gemeinde, Solisten, verschiedene Chorgruppen, Organisten und andere Instrumentalisten. Liturgische Musik ist hinsichtlich ihrer Texte, historisch selten in Bezug auf Melodien, von der kirchlichen Autorität vorgegeben, oder sie ist Ausdruck des kreativen Wollens gemeindlicher Basis im Einklang oder in Spannung zu amtlichen Regelungen.
b) Geistliche Musik ist Musik mit christlichen Inhalten, die außerhalb der verschiedenen Gottesdienstformen konzertant aufgeführt wird. Dies kann liturgische Musik sein, die im Laufe der Zeit ihre Funktion in der Liturgie verloren hat oder zusätzlich im Kirchenkonzert oder im Konzertsaal dargeboten wird (z. B. große Messen von J. Haydn, Vespern und Litaneien von W. A. Mozart, Passionsvertonungen, Orgelmusik). Dazu kommen alle oratorischen Werke, die a priori für konzertanten Gebrauch in Kirche und Konzertsaal gedacht sind (z. B. Sepolcro, Oratorien, Kirchenraum-Musik).
c) Religiöse Musik ist Musik nicht christlicher religiöser Gemeinschaften.
Musica (Musik) meint über Jh.e hinweg die spekulativ-theoretische Betrachtung der Musik, die Praxis der K. hingegen ist der cantus. Ab 1200 verschwimmen diese Grenzen. Der Choral wird lange als Usus, nicht als Kunst betrachtet und erst ab ca. 1820 nunmehr als Kunstmusik zur musica sacra gezählt, womit an sich die (mehrstimmige) komponierte Musik (Mehrstimmigkeit) gemeint ist. Das Konzil von Trient behandelte immer noch den cantus als eine zu erlernende handwerkliche Fähigkeit der Kleriker, während die mehrstimmmige Kunstmusik losgelöst davon an anderem Ort gepflegt werde.
Der Begriff Musica sacra begegnet erstmalig 1614 beim Protestanten Michael Praetorius (Syntagma Musicum 1: De Musica Sacra vel Ecclesiastica, Religionis exercitio accomodata – Von der Geistlichen- und Kirchen-Music, die auff den Gottesdienst gerichtet und vorzeiten wie auch noch jtzunder zum theil darbey gebraucht wird) als Synonym für allgemein geistliche Musik. Der Begriff wird 1860 auf der Kölner Diözesansynode als Gegensatz zu weltlicher Musik gebraucht und von den Cäcilianern übernommen. Er ist von Pius X. 1903 (Motu proprio Tra le sollecitudini / Inter pastoralis officii sollicitudines) bis zur nachkonziliaren Musikinstruktion 1967 (Instructio Musicam sacram) ein Schlüsselbegriff römischer Lehräußerungen zur K., der zunächst ein Repertoire mit bestimmter Stilistik für die Liturgie (Choral, klassische Vokalpolyphonie, neuere K.) bezeichnet und 1967 wesentliche Weiterungen erfährt und nun auch funktional als Musik im Gottesdienst zu verwenden ist.
Von Musik der Kirche ist Musik in der Kirche zu unterscheiden, welche unter bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen auch nicht geistlich sein kann, wenn dies der Würde des Gotteshauses nicht widerspricht (z. B. Symphoniekonzert).
K. ist heute (d. i. nach dem 2. Vatikanischen Konzil) grundsätzlich Aufgabe der gesamten Gottesdienstgemeinde als Ausdruck ihrer bewussten und vollen inneren wie äußeren Teilnahme (actuosa participatio) an der Feier. Der Kirchenchor als eine auf die Musik spezialisierte Gruppe der Gemeinde agiert in Stellvertretung aller. Dies begründet die Dignität des Gemeindegesangs mittels Kirchenlied und anderer Formen, welcher keinen Ersatz für das Fehlen des Chores darstellt, sondern Basis aller liturgischen Musik ist. Diese gleichermaßen altkirchliche wie nachkonziliare Anschauung steht in Widerspruch zu jenen mittelalterlichen und neuzeitlichen Konzeptionen, bei denen Liturgie und damit auch liturgische Musik Klerikersache war und die Gläubigen die „Messe hören“ bzw. ihr „beiwohnen“ mussten. Dem widerspricht nicht die auch heute gültige Differenzierung der musikalischen Dienste in der Liturgie auf verschiedene Ausführende bzw. Gruppen.
Eine wichtige Funktion erfüllt der Kantor. Er ist im klassischen Sinne Sänger, Vorsänger und Leiter des Gemeindegesangs. Im Westen wurde dieser Dienst im Unterschied zur Ostkirche (Kirchenmusik, griechisch-orthodoxe) nur sehr selten als einer der niederen Weihegrade angesehen. Im (mittelalterlichen) Kloster (Klosterkultur) ist der Kantor meist auch Bibliothekar und oberster Leiter der Musik, während der cantor hebdomadarius (Wochenkantor) unter seiner Aufsicht konkrete Vorsänger- und Anstimmerdienste vollzieht. Kantoren singen auch als Solistengruppe (2–4). Die schola ist der einstimmige Chor (einschließlich usueller Mehrstimmigkeit), dem auch pueri (Knaben) angehören, die etwa ab dem 6. Lebenjahr für das Klosterleben bestimmt worden sind. Der Choral wird so mehrfach auch mit Oberstimmen in Oktavenparallelen ausgeführt. Die Hofkapellen bestanden aus geistlichen und weltlichen Sängern, häufig unter der Leitung eines Priesters, da K. als Teil der Liturgie grundsätzlich Klerikersache war (Kapelle). Ein wesentlicher Teil der K. wurde durch die Latein- bzw. deutschen Schulen in größeren und kleineren Orten abgedeckt. K. gehörte zu den primären Aufgaben des Lehrers (Praecentor), der diese mit seinen Gehilfen (Succentor) und den Schülern zu vollziehen hatte. In der Barockkultur wurde die K. an Kathedralen von Chorvikaren, Domchoralisten und Kapellknaben (manchmal bis zum Beginn des 20. Jh.s) getragen, das klösterliche Musikwesen blühte durch die Musikpraxis der Konventualen und Klosterschüler. Musizieren wurde als Erfüllung der von der Benediktregel vorgeschriebenen Handarbeit gesehen. In Kleinstädten wurden vom Magistrat häufig ein Organist und ein Lehrer für die K. besoldet. Die Vokalmusik leitete der Lehrer, dem ein Tenorist (häufig der Mesner) und 3 pueri zur Seite standen, für deren Ausbildung und Versorgung dem Lehrer ein Stipendium des Magistrats zur Verfügung stand. Die Instrumentalmusik wurde meist von den Stadttürmern (Thurner) gestellt.
Der nicht gerade billigen K.-Pflege widmeten sich im 18. Jh. auch musikalische Bruderschaften, dies waren die ersten Kirchenmusikvereine, oft unter dem Patronat der hl. Cäcilia (z. B. Wien St. Michael 1725). Die in den ersten Dezennien gegründeten bürgerlichen Musikvereine (bürgerliche Musikkultur) widmeten sich ursprünglich statutengemäß auch der Pflege der K., so der Musikverein für Steiermark (1815) oder der Musikverein für Kärnten (1828), bis nach 1848 liberale Tendenzen einen Umschwung herbeiführten. Dies ist das erste Vordringen des Laienchorgesangs in der K. Das damit verbundene Singen von Frauen in der Kirche war lange umstritten, Verbote wurden ignoriert und waren nicht durchsetzbar. Die Cäcilianer förderten nach Kräften Knabenchöre, zumindest an den Kathedralen. Das Verdienst der diözesanen Cäcilienvereine (Brixen 1856 noch vor dem Allgemeinen Cäcilienverein für die Länder deutscher Zunge [ACV 1868], Salzburg 1872, Vorarlberg 1870, Österreichischer Cäcilienverein [Gmunden, als Gegengründung von J. E. Habert] 1871, Graz-Seckau und Linz 1875, Gurk-Klagenfurt und Laibach 1876, St. Pölten 1886, Marburg 1887) im Dachverband des ACV (außer Gmunden) war das Vordringen der Kirchenchöre bis in die kleinsten Dörfer. Das rege kirchenmusikalische Leben durch die Vereine ist in deren Zeitschriften und Jahresberichten gut dokumentiert und zeigt die ernsten Bemühungen um eine liturgisch-musikalische Erneuerung der K. im Sinne der kirchlichen Restaurationsbemühung, zu der auch die Neuorientierung bei Kirchenlied und Kirchengesangbuch gehört.
Die Aufhebung durch das NS-Regime (Nationalsozialismus) 1941 bedeutete für die meisten Vereine das tatsächliche Ende, so auch für viele Dommusik- und pfarrliche Cäcilienvereine, welche die K. auf Vereinsbasis organisiert hatten. Eine Wiederbelebung nach 1945 fand meist nicht statt, die Interessen des ACV in Österreich vertritt heute (2003) die Österreichische K.-Kommission.
Die Zeit der Liturgiereform nach dem Zweiten Vatikanum bedeutete eine Krise, verbunden mit einer Neuorientierung für viele Chöre, manche beendeten ihr Wirken. Die Sorge um den Verlust der Pflege althergebrachter K., v. a. der Orchestermesse, erwies sich gerade in Österreich als unbegründet. Es gab auch zahlreiche Neugründungen unter geänderten Bedingungen. Bei einer Erhebung 1984/85 meldeten sich insgesamt 1053 Chöre mit etwa 30.000 Sängerinnen und Sängern. Diese Zahlen müssen jedoch deutlich nach oben korrigiert werden, da sich viele bestehende Chöre nicht an der Umfrage beteiligt hatten (z. B. Graz: 42 % der Pfarren). Neue Entwicklungen ergeben sich aus der geänderten pfarrlichen Situation, z. B. Kirchenchöre gemeinsam für mehrere Pfarren, weltliche Chöre, die auch K. pflegen usw. Neu ist das Phänomen von Großchören mit 1.000–2.500 Mitwirkenden bei Katholikentagen (z. B. Graz 1981), Papstbesuchen (1983, 1988) oder der 2. Ökumenischen Versammlung in Graz 1997.
Die größeren Dommusiken werden von je einem hauptamtlichen Domkapellmeister und Domorganisten getragen. Neben dem Domchor existiert meist ein Kammerchor, eine Choralschola sowie diverse Kinder- und Jugendensembles (Salzburg heute: Domkapellknaben und -mädchen) und eine Reihe von Kantorinnen und Kantoren.
In größeren Gemeinden wird die K. von akademisch ausgebildeten K.erinnen und K.ern getragen, welche auch diözesane Bildungsaufgaben wahrnehmen (Regionalkantoren). Die meisten Stellen dieser Chorleiter und Organisten in Personalunion sind teilzeitig, verbunden oftmals mit musikpädagogischer Tätigkeit. Zahlreiche nebenberufliche K.er mit einer Basisausbildung arbeiten auch ehrenamtlich. Jede Diözese (einschließlich der Militärdiözese) erhält ein K.-Referat und zu dessen Beratung eine diözesane K.-Kommission. Die Referatsleiter bilden den Kern der Österreichischen K.-Kommission, welche u. a. die Zeitschrift Singende Kirche herausgibt, Bildungsveranstaltungen wie Werkwochen durchführt und Behelfe für die pfarrliche Praxis ediert.
Über Jh.e haben Klöster und Schulen für die Ausbildung des kirchenmusikalischen Nachwuchses gesorgt. Eine besondere Rolle kam dabei jenen Lehrern zu, die als städtische Angestellte Knaben in ihrem Haus auszubilden und zu versorgen hatten. Die Gegenleistung der Kinder war der kirchenmusikalische Dienst. Bedeutsam waren Kapellknabeninstitute in Zentren wie Salzburg und Wien (der Stephansdom war für J. Haydn und die k. k. Hofkapelle für Fr. Schubert eine wichtige Karrierestation) oder Sängerknabenkonvikte wie z. B. in St. Lambrecht, Seckau, Wilten, Altenburg, Göttweig, Liefering, Melk, St. Florian, Zwettl oder St. Gabriel bei Mödling (Sängerknaben unter dem Wienerwald). Die Wiener Sängerknaben verstehen sich als Nachfolgeorganisation der Knaben der Wiener Hofkapelle.
Im seit Maria Theresia staatlich streng geregelten Schulbetrieb galt der kirchenmusikalischen Schulung der zukünftigen Lehrer in den Präparandien bzw. Lehrerbildungsanstalten ein besonderes Augenmerk. Die bürgerlichen Musikvereine organisierten ein Schulwesen, aus dem zahlreiche heutige Konservatorien oder Universitäten für Musik und darstellende Kunst hervorgingen (MSch. Mozarteum des Salzburger Dom-Musik-Verein 1841, Unterricht am Musikverein für Steiermark seit 1930, Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde Wien, auch Städtische MSch. Bregenz 1814). Diese Schulen hatten Orgelklassen oder Klassen für Generalbass und Choral oder Chorgesang und setzten sich das Ziel, die K. zu verbessern. Das kircheneigene Schulwesen erhielt eine neue Basis mit den von den Cäcilienvereinen gegründeten Diözesankirchenmusikschulen (zuvor noch Wien St. Anna, Kirchenmusikvereinsschule 1840; Grazer Diözesankirchenmusikschule 1888–1963, Wiener Ambrosiusschule 1881 neben der Cäcilienvereinsschule – seit 1906 Lehranstalt für kirchliche Tonkunst, Klagenfurter Organistenschule 1897–1950, Organistenschule Cilli (Celje/SLO) 1899) oder einem florierenden Kurswesen.
Heute ist die Ausbildung der K.er standardisiert. Sie werden eingestuft nach den vier Ausbildungsständen A (akademisch geprüfter K.er, Mag. art.), B1 (akademische Grundausbildung, Bakkalaureat bzw. früheres Kurzstudium), B2 (höhere Ausbildung), C (Basisausbildung) sowie D (ohne Prüfung). Zur Durchführung der C- und B2-Ausbildung haben die Diözesen Wien, Graz, Linz und St. Pölten jeweils ein Diözesankonservatorium für K. errichtet. Andere Diözesen organisieren diesen Unterricht in Kursform, auch dezentral über die Regionalkantoren. K.-Ausbildung existiert auch an den Landeskonservatorien in Klagenfurt, Innsbruck, Feldkirch und Linz. Das Anforderungsprofil für Unterricht und Prüfung regelt eine Ausbildungsordnung der Österreichischen K.-Kommission. Die akademische Ausbildung wird an den K.-Instituten (früher: Abteilungen) der MUniv. Wien (seit 1910, Leiter waren V. Goller, A. Weißenbäck, J. Lechthaler, F. Kosch, H. Kronsteiner, H. Haselböck, E. Ortner und P. Planyavsky), Graz (seit 1963, Leiter waren Ph. Harnoncourt, J. Trummer, Ernst Triebel und F. K. Praßl) und Salzburg (seit 1962, Leiter waren J. Schabaßer, Stefan Klinda und Albert Anglberger) angeboten, in Graz existiert seit 2002 ein spezielles Magisterstudium für Gregorianik (Choral).
Der Weiterbildung dienen die diözesanen Werkwochen für Chöre, Organisten, Neues geistliches Lied oder Gregorianik, besonders die gesamtösterreichische Salzburger Werkwoche. Kantoren- und Organistenschulungen sowie Chortage werden hauptsächlich über die Regionalkantoren angeboten.
Die einzelnen kirchenmusikalischen Gattungen entstanden sowohl aus der Liturgie- als auch aus der Musikentwicklung. Basis der meisten älteren Gesangsgattungen ist das liturgische Rezitativ und dessen spezielle Ausführungstechnik, die Kantillation, d. h. der Sprechgesang. Den primären Ausführenden (Priester, Diakon, Lektor, Kantor) sind Orations-, Lektions- und Präfationstöne sowie etliche Sondertöne (z. B. für die Passionen oder das Exsultet und Formeln für liturgische Dialoge) zugeordnet. Ein „Ton“ besteht aus einer Rezitationsnote, die von einer Eröffnungsformel eingeleitet und von Kadenzformeln beschlossen wird, welche akustische Satzzeichen zur Verdeutlichung der Textstruktur darstellen. Strukturell am nächsten verwandt ist die Psalmodie in ihren unterschiedlichen Ausprägungen als Gemeinde-, Cantica-, Mess- und Solopsalmodie. Das spezielle Repertoire des Stundengebets (Offizium) besteht aus Antiphonen, kurzen und langen Responsorien, der Kleinform des Versikels und dem Sonderkorpus der metrischen bzw. strophischen Hymnen. Das gewöhnliche feriale Repertoire dieser Gattungen tendiert zu rezitativischen Strukturen, die Festgesänge zeigen eine weit größere musikalische Entfaltung. Die Messgesänge sind antiphonal (Begleitgesänge einer liturgischen Handlung, z. B. Kommuniongang) oder responsorial (selbständige Gesänge). Beiden Gattungen gemeinsam ist eine dialogische Struktur der Ausführung, es wechseln immer zwei Handlungsträger ab, z. B. Schola und Kantor. Die oligotonischen antiphonalen Gesänge sind Introitus und Communio,die melismatischen responsorialen Gesänge sind Graduale, Alleluia und Tractus. Das Offertorium ist ein melismatischer Begleitgesang. Ein Sonderrepertoire sind die strophischen metrischen Sequenzen. All diese Gesänge bilden das klassische Proprium (die Eigengesänge einer Messe). Das Ordinarium (die gleichbleibenden Gesänge einer Messe) setzt sich aus den selbständigen Gesängen Kyrie, Gloria und Sanctus (mit Benedictus, dem Bekenntnistext Credo und dem Begleitgesang Agnus Dei zusammen. Die Zyklusbildung beim Ordinarium ist eine Folge der Entwicklung mehrstimmiger Komposition. Die meisten anderen Feiern schöpfen ihr Gesangsrepertoire aus Messe und Stundengebet. Für die Entwicklung der bisher genannten Gattungen ist zunächst deren Textsorte ausschlaggebend. Ab 1200 entwickeln sich auch rein musikalische Gattungen, die mit, neben oder gegen die Textstruktur gestaltet sind. So sind z. B. Sonatensatz- und Rondoform kein adäquates Ausdrucksmittel der Textstruktur eines Credo.
Musikalische Hauptform der K. ist seit Guillaume Dufay die Messe, der Ordinariumszyklus. Bis ins 18. Jh. ist die Entwicklung dieser Gattung eine der Leitlinien für die allgemeine musikalische Entwicklung. Ihre Bandbreite reicht von billiger Gebrauchsmusik bis hin zu singulären Kunstwerken. Der Sonderfall einer Kombination von Proprium und Ordinarium ist das Requiem (Totenmesse). Durch die Neuordnung der Messgesänge in der Musikinstruktion 1967 ist die Gattung des Mess-Ordinariums obsolet geworden, als historisch bedeutsame Gattung dürfen und sollen Ordinarien weiter gesungen werden, entsprechen aber nicht der Idealkonzeption heutiger Liturgie und sollten auch nicht neu komponiert werden. Eine Großform ist der musikalische Vesperzyklus, bestehend aus fünf (monastisch: vier) Psalmen und dem Magnificat, eventuell auch dem Hymnus. Den liturgischen Erfordernissen entsprechend sind häufig Psalmen auch als Einzelsätze vertont und miteinander kombiniert worden. Größere Gattungen sind die Passion, die Litanei und das Te Deum. Kleinformen sind Antiphonen – darunter auch die marianischen Antiphonen (Salve regina, Regina caeli, Alma redemptoris mater, Ave regina caelorum, Sub tuum praesidium) – und die Hymnen. Die weitaus am öftesten vertonten Hymnenstrophen sind der Schluss des Fronleichnamshymnus Pange lingua gloriosi corporis mysterium mit dem Incipit Tantum ergo sacramentum, welche beim Segen mit der Monstranz gesungen worden sind.
Im 18. Jh. entsteht eine andere Form der Messe, die (deutsche) Singmesse. Diese ist ein Zyklus von muttersprachlichen Liedstrophen zu den verschiedenen Teilen der eucharistischen Liturgie (Normalmessgesang Wir werfen uns darnieder, „Haydnmesse“ Hier liegt vor deiner Majestät, „Schubertmesse“ Wohin soll ich mich wenden). Ursprünglich für den Gemeindegesang konzipiert, werden Singmessen auch für Chöre geschrieben, nach der Liturgieform auch als Mundartmessen mit z. T. liturgiefernen Texten. Solche Produkte sind liturgisch fragwürdig. Ein Spezialfall der römischen Liturgie ist das muttersprachliche Kirchenlied, das im Mittelalter entstanden und von Martin Luther in einen neuen liturgischen Kontext gestellt worden ist. War es im Mittelalter Bestandteil der Liturgie selbst, wurde es in der neuzeitlichen Liturgik als paraliturgisch angesehen, erhielten aber mit der jüngsten Liturgiereform wieder den Status eines echten liturgischen Elements.
Über die historische Entwicklung der K. in Österreich berichten zahlreiche Einzelartikel zu Personen, Sachen, Orten, Landschaften und musikalischen Epochen, sodass hier nur ein grober Überblick über die bedeutendsten Entwicklungslinien gegeben zu werden braucht. Die Entfaltung der einstimmigen K. ist im Artikel Choral dargestellt. Eine erste Blütezeit der mehrstimmigen Musik stellen die Hofkapellen des Spätmittelalters und der Renaissance dar. 1393 wird in Salzburg von Erzb. Pilgrim II. eine Domkantorei gegründet, an der unter Erzb. Matthäus Lang (1519–40) H. Finck und P. Hofhaimer wirken. In Wien wird 1460 die Kantorei an St. Stephan gegründet. Friedrich III. (1440 König, 1452 Kaiser) errichtet in Graz eine Hofkapelle, die unter J. Brassart einen kurzen Aufschwung nimmt und eine größere Blüte erst wieder unter Erzhzg. Karl II. ab 1564 erlangt, wo J. de Cleve und Lambert de Sayve als die letzten Niederländer neben den modernen Italienern wie A. Padovano wirken. Diese Kapelle verlegt Ferdinand II. als Kaiser 1619 nach Wien und errichtet so die Basis der musikalischen Hochblüte am Wiener Kaiserhof. Die Innsbrucker Hofkapelle unter Kaiser Maximilian I. glänzt mit H. Isaac und P. Hofhaimer sowie in der 1. Hälfte des 17. Jh.s mit J. Stadlmayr.
Eine Glanzzeit österreichischer K. ist die barocke Epoche. Die Musikzentren der großen Städte und in den vielen Klöstern stehen an vorderster Front der Musikentwicklung, die Gattung der Messe erfährt in der süddeutsch-österreichischen K. ihre große Entwicklung von der konzertierenden Messe hin zur symphonischen der Wiener Klassik und Romantik. In Salzburg gründet Erzb. Wolf Dietrich 1591 die Hofkapelle und reorganisiert 1597 die Dommusik. Eine besondere aufführungspraktische Situation im Salzburger Dom bilden die vier Pfeilerorgeln, die zusammen mit der großen Westorgel und dem Positiv vor dem Presbyterium im Zusammenspiel die Angelpunkte zur Entfaltung eines Raumklangkonzeptes waren, welches einmalig war. St. Bernardi, H. I. F. Biber, Ge. Muffat, J. E. Eberlin, L. und W. A. Mozart sowie J. M. Haydn sind die bedeutendsten Komponisten bis zum Ende der Hofkapelle im Zuge der Säkularisierung. Die Wiener Hofkapelle festigt ihren Ruf mit Komponisten wie A. Bertalli, G. F. Sances, A. Draghi, J. H. Schmelzer, J. J. Fux und A. Caldara, zu denen sich die komponierenden Kaiser selbst gesellen, allen voran Leopold I. Jedes der größeren Stifte und Klöster hatte seine komponierenden Konventualen, deren rege Musikproduktion durch Austausch ihre Wege bis nach Böhmen, Mähren und Ungarn fand. Unter den wichtigsten Klosterkomponisten, die Formen wie die Orgelsolomesse entwickelten, sind F. X. Widerhoffer in Mariazell, J. G. Zechner in Melk, F. Aumann in St. Florian und G. Pasterwitz in Kremsmünster.
Die Zeit der Wiener Klassik ist einerseits ein Höhepunkt der Messkomposition mit den Werken der Brüder Haydn und Mozarts sowie A. Salieri, J. G. Albrechtsberger und S. Sechter, andererseits werden durch die josephinischen Reformen viele Traditionen zerschlagen. Höhepunkte romantischer K. bilden Schubert und A. Bruckner, während ein Großteil der Komponisten nachklassische Werke mit epigonalen Zügen schreibt. Die Reformen des Cäcilianismus und dessen einseitige Sichtweisen koppeln auch in Österreich die K. von der allgemeinen Musikentwicklung ab. Als Schöpfer kirchlicher Gebrauchsmusik ragen Ende des 19. und Anfang des 20. Jh.s I. Mitterer und A. Faist heraus. Große (Dom)Kapellmeisterpersönlichkeiten sind J. Messner in Salzburg, A. Lippe in Graz und K. Koch in Innsbruck. In der 2. Hälfte des 20.Jh.s findet eine jüngere Generation von Komponisten wieder Anschluss an Zeitstile und stellt sich auch in den Dienst der Liturgiereform. Bedeutendere Werke schaffen A. Heiller, A. F. Kropfreiter, J. F. Doppelbauer, P. Planyavsky und M. Radulescu. Der jüngsten Generation gehören Komponisten wie Th. D. Schlee, K. Estermann und W. Sauseng an. Im Stile der Avantgarde schuf H. M. Preßl etliche K.-Werke.
Über Orgeln und Orgelmusik informieren die Stichworte Organist, Orgel(Musik), Orgelbau, Orgelmesse, Orgelsolomesse, Orgelspiel. Die Liturgiekonstitution 1963 hat die Vorrangstellung der Pfeifenorgel in der lateinischen Kirche hervorgehoben und bestätigt, jedoch nicht exklusiv festgelegt. Die Orgel findet im Gottesdienst im solistischen Spiel und zur Begleitung des Gesangs Verwendung. Solistisches Spiel als Element der Liturgie ist seit 1967 möglich anstelle der Begleitgesänge in der Messe, also zum Einzug, während der Gabenbereitung und der Kommunion, sowie am Ende der Messe (neue Form der Orgelmesse). Das solistische Spiel soll nach römischen Regeln, die in Österreich derzeit nur alternativ gelten, in der Advent- und Fastenzeit unterbleiben, die Begleitung des Gesangs ist immer erlaubt, auch an früher „orgelfreien“ Tagen, wie z. B. am Karfreitag. Orgelmusik ist ein wesentlicher Bestandteil von Kirchenkonzerten (Orgelkonzert, Orgel plus Instrument, Orgel-Orchesterkonzert), das Repertoire dafür ist statistisch gesehen großteils liturgische Musik aus katholischer und protestantischer Tradition, zum geringeren Teil reine Konzertsaalmusik. Kirchenkonzerte sollen einen speziellen Verkündigungsauftrag wahrnehmen und die breite Palette der Themen eines Kirchenjahres musikalisch artikulieren. Aufgrund dieser Tatsachen ist auch eine Unterscheidung zwischen „Kirchenorgel“ und „Konzertorgel“ unsachgemäß, da die Repertoires für Liturgie und Konzert weitestgehend deckungsgleich sind. Für den Bau und die Restaurierung von Orgeln werden von den einzelnen Gemeinden große (finanzielle) Anstrengungen unternommen, Förderungen der öffentlichen Hand sind nur begrenzt vorhanden. Die einzelnen Maßnahmen werden vom diözesanen Orgelreferenten oder von einer Kommission begleitet, welche/r für die Expertisen zuständig ist, den Baufortschritt begleitet und die Abnahmeprüfung (Kollaudierung) durchführt. Zur Beratungstätigkeit des Orgelreferenten gehört auch die Sorge und strategische Planung einer vielfältigen „Orgellandschaft“. In der Österreichischen K.-Kommission ist eine eigene Fachkommission für den Orgelbau eingerichtet.
K. als Bestandteil der Liturgie unterliegt wie diese der kirchenamtlichen Gesetzgebung. Deren generelles Ziel ist Stärkung der Einheit von Liturgie und Musik und die Wahrung ihres gottesdienstlichen Charakters gemäß dem jeweiligen theologischen Verständnis. Dem dient die Abwehr alles „Weltlichen“ in ihren zeitbedingten Ausdrucksweisen. K. in Klöstern wird geregelt in Lebensordnungen wie der Benediktregel 529, der Aachener Regel 816 oder der Augustinusregel. Dazu kommen die Consuetudines oder Konstitutionen der mittelalterlichen Klöster wie die Consuetudines Rodenses für das Salzburger Domstift oder die Consuetudines der Melker Reform.
Bis in die Neuzeit war die Ordnung der K. bischöfliches Recht und somit in teilkirchlicher Verantwortung, die auch auf Diözesan- oder Metropolitansynoden wahrgenommen worden ist. Unter den Auspizien der cäcilianischen Reform veröffentlichen noch etliche Bischöfe diözesane Richtlinien (z. B. Graz 1879).
Eine päpstliche Regelung der K. mit gesamtkirchlicher Relevanz geschah erstmals 1324 durch das Dekret Docta sanctorum patrum, in dem die Auswüchse der Ars nova kritisiert werden. Seit dieser Zeit werden immer wieder Textverständlichkeit eingemahnt und eine Kompositionsweise, die Assoziationen zu unterhaltender Musik aller Art ausschließt. Das Konzil von Trient behandelte wiederum Fragen der mehrstimmigen Musik, im Caeremoniale Episcoporum 1600 ist das Orgelspiel im bischöflichen Gottesdienst geregelt. Dokumente der Barockpäpste 1657, 1678 und 1692 behandeln speziell römische Verhältnisse, ebenso wie die Enzyklika Annus qui 1749 von Benedikt XIV., welche erstmals Grundsätze „echter K.“ definierte, v. a. aber den Pilgern des Heiligen Jahres 1750 eine vorbildliche K. in Rom vorführen wollte.
Der Sonderfall eines massiven staatlichen Eingriffs in die K. war die josephinische Gottesdienstreform ab 1783 bzw. das Salzburger Pendant des Fürsterzb.s H. Colloredo. Die Figuralmusik wurde auf finanziell potente Stadtkirchen beschränkt und anstelle dessen der Normalmessgesang Wir werfen uns darnieder allgemein eingeführt (Deutsches Amt). Obschon immer wieder gelockert, verschwand die josephinische Gottesdienstordnung definitiv erst 1850.
Den Piuspäpsten des 20. Jh.s war es vorbehalten, der Weltkirche detailreiche und kleinliche Regelungen für die liturgische Musik vorzuschreiben, nachdem die Ritenkongregation im Choralstreit gegen Ende des 19. Jh.s schon mit solchen Versuchen begonnen hatte. Das Motu proprio Tra le sollecitudini Pius’ X. 1903 war einerseits ein zukunftsweisendes Reformdokument, das die liturgische Stellung der musica sacra deutlich herausstrich und die Gemeindebeteiligung in der Messe gemäß damaligen Regeln einmahnte. Das waren Forderungen, die erst in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums voll zum Durchbruch kommen sollten. Andererseits vertrat Pius X. das cäcilianische Stilideal von Choral und klassischer Vokalpolyphonie, schränkte den Gebrauch der Orchestermesse weitestgehend ein und verbot den Frauengesang im Chor, was in Österreich undurchführbar war. Dies alles führte zu heftigen Irritationen, sodass Kaiser Franz Joseph seinen Burgpfarrer Laurenz Meyer zur Rettung der Klassikermessen zum Papst schickte, welcher beschied: „So wollen Wir also für Wien eine Ausnahme machen.“ Auf der Generallinie dieses Dokumentes lagen in unterschiedlichen Detailverordnungen die Apostolische Konstitution Pius’ XI. Divini cultus sanctitatem 1928 und die Enzyklika Pius’ XII. Musicae sacrae disciplina 1955, der die Ritenkongregation 1958 eine Instruktion nachschob.
Eine gründliche Neuorientierung auf der theologischen Basis der genannten Dokumente samt einer Befreiung von kleinlicher Gängelei der K. brachte die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums Sacrosanctum Concilium 1963, welche auf stilistische Festlegungen der K. verzichtete und somit lokale Traditionen bestärkte. Detailregelungen sind den Diözesanbischöfen oder Bischofskonferenzen überlassen. K. ist pars integralis der Liturgie und deren forma nobilior. Die Forderung der vollen und tätigen Teilnahme der Gemeinde an der Feier korrespondiert mit der Zulassung von Volkssprachen. Dem widerspricht nicht das Anliegen der Pflege des Thesaurus musicae sacrae. Etliche Ausführungsbestimmungen zur Liturgiekonstitution enthält die Musikinstruktion 1967 Musicam sacram, welche das Grundlagendokument heutiger K.-Praxis darstellt, das zusammen mit den kirchenmusikalischen Regelungen der einzelnen liturgischen Bücher gelesen werden muss. K.-relevante Aussagen enthält auch der Codex iuris canonici 1983. Das Schreiben der Gottesdienstkongregation an die Vorsitzenden der Bischofskonferenzen De concentibus in ecclesiis (Konzerte in Kirchen) rät 1987 den Bischofskonferenzen, für Kirchenkonzerte Vorschriften nach mitgeliefertem Muster zu erlassen, welche v. a. an italienischen Verhältnissen Maß nehmen. K.-Aspekte behandelt auch das Rundschreiben der Gottesdienstkongregation 1988 Paschalis sollemnitatis (Über die Feier von Ostern und ihre Vorbereitung). Eine Zusammenfassung der aktuellen Regelungen einschließlich der regionalen Besonderheiten stellt das Zeremoniale für die Bischöfe 1998 dar. Nach 1967 erschienen einige teilkirchliche Richtlinien zur K., v. a. Kirchenkonzerte betreffend, darunter die Richtlinien der Österreichischen Bischofskonferenz über Kirchenkonzerte 1976 und 1987, wo die römischen Vorstellungen auf österreichische Bedürfnisse hin adaptiert worden sind.
Von einer allgemeinen Theologie der Musik (Musik als Abbild der Schöpfungsordnung usw.) muss eine theologische Reflexion der K. unterschieden werden. Eine Theologie der K. orientiert sich zunächst an grundlegenden Prinzipien der Liturgie. Diese ist ein zutiefst dialogisches Geschehen, bei dem Gott sich zuerst dem Menschen zuwendet und spricht (katabatische Dimension) und dann der Mensch darauf antwortend reagiert (anabatische Dimension). Liturgie ist zuerst Werk Gottes am Menschen und dann erst menschliche Zuwendung zu Gott. Diese Grundstuktur gott-menschlicher Kommunikation spiegelt und verdeutlicht sich in den Formen der Liturgie und K., welche meist auf das Zusammenwirken zweier Handlungsträger angelegt sind. K. ist nicht Beiwerk oder nur Verschönerung der Liturgie, sondern deren integraler Bestandteil und somit unverzichtbar für deren Vollständigkeit. Sie ist die forma nobilior des Gottesdienstes, erst mit Musik können sich die Dimensionen der Liturgie in ihrer Fülle entfalten. K. muss liturgiegemäß (sanctitas), echte Kunst (bonitas formae) und gemeindegemäß (universitas) sein. Sie ist grundsätzlich Aufgabe der ganzen Gemeinde und nicht nur ihrer darauf spezialisierten Teile. K. realisiert allgemeine Gebetsstrukturen und ist daher anamnetisch, indem sie an das Heilswirken Christi erinnert und dieses vergegenwärtigt. Diese rememorative Funktion der K. richtet sich an die Gemeinde nach innen. K. ist epikletisch als Bitte und Gebet der Gemeinschaft und des Einzelnen für die Anliegen von Kirche und Welt und die individuellen Nöte und Bedürfnisse. K. ist doxologisch. Sie bringt das Lob Gottes zum Klingen, sie artikuliert den Ruhm und die Ehre Gottes und seine Anbetung durch alles Geschaffene. K. ist eschatologisch. Sie ist präludium vitae aeternae, das Vorspiel des ewigen Lebens, eine Ahnung von der Schönheit des Himmels. K. ist Bestandteil der Verkündigung der Kirche, „Predigt in Tönen“. Dazu gehört ihre katechetische Dimension (z. B. Glaubensverkündigung, -unterweisung und -vertiefung im Kirchenlied) und ihr missionarischer Charakter (Glaubensbegeisterung und -vorbild), der sich nach außen richtet und sich einer Welt zuwendet, die zutiefst erlösungsbedürftig ist. K. ist ein Symbol der Kirche in ihrer Verfasstheit als mystischer „Leib Christi“, zu dessen Funktion eine Vielzahl unterschiedlicher Dienste, Aufgaben und Charismen gehört, die erst im Zusammenwirken eine größere Einheit werden. Das Bild des Orchesters kann auch Bild eines Glaubensbewusstseins sein, das sich im Zusammenklang unterschiedlicher Stimmen manifestiert: „die Wahrheit ist symphonisch“ (Hans Urs v. Balthasar). K. ist Ausdruck der menschlichen Befindlichkeiten, indem sie Trauer und Hoffnung, Sorgen und Nöte, Leiden und Freuden der Menschen artikuliert.
Der neuere Begriff K.-Wissenschaft soll das Bemühen bezeichnen, in umfassender Weise das Wissen über kirchenmusikalische Phänomene in Praxis und theoretischer Reflexion zu sammeln, zu erforschen, zu interpretieren, zu vermitteln und auch für die Praxis nutzbar zu machen. Daher ist K.-Wissenschaft historisch, systematisch, analytisch und praktisch orientiert. Kritische Reflexion über K. ist so alt wie sie selbst, als akademische Disziplin ist sie primär an musik- oder liturgiewissenschaftliche Lehrstühle als deren möglicher Forschungsschwerpunkt gebunden. Spezielle Professuren existieren für Teilbereiche wie Hymnologie oder Gregorianik.
Zu den sich teilweise überschneidenden Teilgebieten gehören die Geschichte der mehrstimmigen K., Gregorianik und Hymnologie, Organologie und zahlreiche Themen von klassischen Bereichen der Theologie wie Liturgiewissenschaft, Bibelwissenschaft, Dogmatik, Patrologie und ökumenische Theologie sowie Pastoraltheologie. Der Fächerkanon historischer und systematischer Musikwissenschaft ist ebenso berührt wie Fragen der Sprach- und Literaturwissenschaft. K.-Wissenschaft ist von ihrem Gegenstand her per se interdisziplinär angelegt und nur synoptisch aus verschiedenen Perspektiven heraus praktizierbar. Komparative Methoden aus einem multikulturellen und ökumenischen Blickwinkel spielen dabei eine große Rolle.
Die Aufgabenfelder einer K.-Wissenschaft in Österreich sind vielfältig. Zahlreiche Quellen der Gregorianik sind erst ansatzweise erforscht, eine Geschichte der österreichischen Kirchenlied- und Gesangbuchtradition ist erst in Teilen geschrieben, ein systematischer Katalog alter wie neuer Orgeln und deren sachgerechte Beschreibung fehlt. Die kirchenmusikalische Praxis steht vor zahlreichen Herausforderungen der Zukunft, deren Bewältigung einer wissenschaftlichen Begleitung bedarf. Aufgabe einer K.-Wissenschaft wäre auch, das Reflexionsniveau bei Schöpfern neuer K. zu heben und eine größere Sensibilität für die komplexen Zusammenhänge einer Musik im Gottesdienst zu fördern.
Teilgebiete werden an den K.-Instituten der MUniv.en sowie an den theologischen Fakultäten unterrichtet. Einige musikwissenschaftliche Lehrstühle beschäftigen sich auch mit Fragen der K. Als österreichische Publikationsforen dienen hauptsächlich die Zeitschriften Singende Kirche, Heiliger Dienst, Österreichisches Orgelforum und Musicologica Austriaca.
Literatur
(alphabet.) MGÖ 1–3 (1995); [Kat.] Musik i. d. St. 1980; J. Gurtner, Die katholische K. Österr.s im Lichte der Zahlen 1936; R. F. Hayburn, Papal Legislation on Sacred Music 1979; H. Hollerweger, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österr. 1976; E. Jaschinski, Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? 1990; A. Kollbacher, Musikpflege in Mariazell 1995; W. Kurzschenkel, Über die theologische Bestimmung der Musik 1971; H. B. Meyer/R. Pacik, Dokumente zur K. 1981; H. Musch (Hg.), Musik im Gottesdienst, 2 Bde. 51994; MGG 9 (1998) [Vatikanisches Konzil]; F. K. Praßl in Internationale Katholische Zeitschrift (IKZ) Communio 29 (2000); F. K. Praßl in RGG 42001[K.-Wissenschaft]; F. K. Praßl in M. Klöckener/B. Kranemann (Hg.), [Fs.] A. A. Häußling, 2 Bde. 2002; H. Rennings/M. Klöckener, Dokumente zur Erneuerung der Liturgie 1–3 (1983–2001); F. W. Riedel, K. am Hofe Karls VI. 1977; F. W. Riedel (Hg.), K. mit obligater Orgel 1999; F. W. Riedel (Hg.), Anton Bruckner. Tradition und Fortschritt in der K. des 19. Jh.s 2001; E. Tittel, Österr. K. 1961; J. Trummer in Ch. Wolff (Hg.), [Fs.] M. Schneider 1985; J. Trummer, Kirchenchöre Österr.s 1987; J. Trummer (Hg.), Kirchenraum – Konzert – Aufführungspraxis 1996; Weissenbäck 1937; Zeremoniale für die Bischöfe 1998; Zs. SK, Wien 1954ff.
(alphabet.) MGÖ 1–3 (1995); [Kat.] Musik i. d. St. 1980; J. Gurtner, Die katholische K. Österr.s im Lichte der Zahlen 1936; R. F. Hayburn, Papal Legislation on Sacred Music 1979; H. Hollerweger, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österr. 1976; E. Jaschinski, Musica sacra oder Musik im Gottesdienst? 1990; A. Kollbacher, Musikpflege in Mariazell 1995; W. Kurzschenkel, Über die theologische Bestimmung der Musik 1971; H. B. Meyer/R. Pacik, Dokumente zur K. 1981; H. Musch (Hg.), Musik im Gottesdienst, 2 Bde. 51994; MGG 9 (1998) [Vatikanisches Konzil]; F. K. Praßl in Internationale Katholische Zeitschrift (IKZ) Communio 29 (2000); F. K. Praßl in RGG 42001[K.-Wissenschaft]; F. K. Praßl in M. Klöckener/B. Kranemann (Hg.), [Fs.] A. A. Häußling, 2 Bde. 2002; H. Rennings/M. Klöckener, Dokumente zur Erneuerung der Liturgie 1–3 (1983–2001); F. W. Riedel, K. am Hofe Karls VI. 1977; F. W. Riedel (Hg.), K. mit obligater Orgel 1999; F. W. Riedel (Hg.), Anton Bruckner. Tradition und Fortschritt in der K. des 19. Jh.s 2001; E. Tittel, Österr. K. 1961; J. Trummer in Ch. Wolff (Hg.), [Fs.] M. Schneider 1985; J. Trummer, Kirchenchöre Österr.s 1987; J. Trummer (Hg.), Kirchenraum – Konzert – Aufführungspraxis 1996; Weissenbäck 1937; Zeremoniale für die Bischöfe 1998; Zs. SK, Wien 1954ff.
Autor*innen
Franz Karl Praßl
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Franz Karl Praßl,
Art. „Kirchenmusik, katholische‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d45e
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.