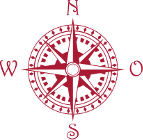Kirchenchöre
Meist rechtlich informelle Vereinigungen für die Kirchenmusik, also nicht unbedingt nur Gesangschöre umfassend. Der aus dem Griechischen stammende Begriff Chor bezeichnete den Platz für einen kultischen Tanz, dann ebenso ein Tanzlied wie die Gruppe der Tänzer, im frühchristlichen Sprachgebrauch die lobpreisenden Scharen der Engel und Heiligen und die feiernde irdische Gemeinde („singen vereint [...] das Lob deiner Herrlichkeit“, Hochgebet, Überleitung zum Sanctus). Da seit dem Frühmittelalter (Mittelalter) der Gottesdienst der römischen Kirche zunehmend als Liturgie der Kleriker (und der Klöster) gefeiert wurde und wegen der lateinischen Sprache der Gesang der Gemeinde sich weitgehend in Andachten, Prozessionen, Wallfahrten und nur in geringem Maß in der Liturgie entfaltete, wurde liturgische Musik ebenfalls weitgehend zu einer Aufgabe von Klerikern. Der Platz des Chores, meist im Altarraum oder in dessen unmittelbarer Nähe, wurde in der Folge ebenfalls „Chor“ genannt. Die Errichtung von Westwerken in der frühromanischen Zeit diente der Teilung der Mönchskonvente in mehrere „Chöre“ für die Feier des Stundengebets. Mit dem Bau von barocken Westemporen sowie monumentaler Orgeln an dieser Stelle ging vielfach die Verlegung der Musikensembles vom Altarraum auf die Westempore einher.
V. a. im evangelischen Bereich bezeichnete „Chor“ sowohl Vokal- als auch Instrumentalensembles. Diese Tradition setzte sich auch in der kath. Kirchenmusik in Österreich fort, so z. B. in Salzburg, wo an Hochfesten auf der rechten vorderen Empore des Domes Solosänger, Organist, Continuogruppe, Fagottisten, Posaunisten und Kapellmeister (der Prinzipalchor) musizierten, auf der gegenüberliegenden Empore die Violinisten und auf den beiden rückwärtigen die Trompetenchöre, im Presbyterium die Chorsänger (Kapellknaben, Domchorvikare und Domchoralisten als Ripienisten).
Die Josephinische Gottesdienstordnung ging davon aus, dass u. a. in Stadtpfarrkirchen „ein ordentlicher Chor“ vorhanden war. Charles Burney berichtet von den „Schülerchören“. Die Bezeichnung „K.“ wurde erst im 19. Jh. üblich, u. a. als Abgrenzung zum bürgerlichen Chorwesen. Sie steht, jedenfalls zeitlich, mit der Oberstimmenbesetzung durch Frauen statt mit Knaben (gemischten Chören Erwachsener anstelle der Schülerchöre oder zusätzlich zu ihnen) im Zusammenhang. In den Berichten der Cäcilienvereine (Cäcilianismus) findet sich die Bezeichnung Pfarr-K. in Unterscheidung zu Chören an Filialkirchen, Klosterkirchen, Kathedralen. Der Chor wird vom Chorregenten bzw. Regens chori geleitet, im 20. Jh. setzt sich die Bezeichnung Chorleiter durch, neben Domkapellmeister u. a. Sonderfunktionen. Jüngere kirchliche Dokumente bezeichnen die Vokalensembles als Sängerchor (Schola, Chor).
Das Trienter Konzil hielt, im Gegensatz zur Reformation, an der lateinischen Liturgiesprache fest. Sie blieb, von geringen Ausnahmen abgesehen, die verbindliche Sprache für die liturgische Musik der römischen Kirche. Die Gemeinde konnte sich, anders als klösterliche Gemeinden, am liturgischen Gesang nur in geringem Maß, z. B. an gregorianischen Ordinariumsgesängen, beteiligen. (Diese für die Liturgie nicht glückliche, erst im 2. Vatikanischen Konzil revidierte Situation war jedoch eine Voraussetzung für die Entfaltung der musikalischen Gattung Messe in der abendländischen Musikgeschichte.) Die „Gültigkeit“ der liturgischen Feier lag jedoch geradezu ausschließlich im ritusgemäßen Vollzug durch den „Zelebranten“ (womit nun nicht mehr die Gemeinde, sondern der die Messe „zelebrierende“ Priester gemeint war) und – zumindest beim „Hochamt“ – auch am liturgiegemäßen (Chor)Gesang, während die Gläubigen der Feier „andächtig beiwohnten“ (Katechismus). Doch auch die liturgische Stellung des Chores war insofern von untergeordneter Bedeutung, als der Zelebrant alleiniger Garant der richtig vollzogenen Liturgie war. Er „las die Messe“, er hatte sämtliche Texte zu rezitieren, auch jene Teile, die vom Chor im vollen Wortlaut gesungen wurden. Die Verselbständigung bzw. Loslösung der Feier am Altar gegenüber der liturgischen Musik war einer der Gründe für die Verlegung der Ensembles auf die Westempore und zum Verständnis von Kirchenmusik als „Verschönerung“ bzw. als schmückendes Beiwerk, das für die Liturgie nicht wesentlich war. Der Platz auf der Westempore gestattete jedoch eine Professionalisierung der Chöre, die Vergrößerung bzw. Erweiterung durch Instrumentalensembles, wie sich dies bis zur instrumental begleiteten Kirchenmusik etwa der Venezianischen Kirchenmusik des 17. Jh.s oder in der Wiener Klassik ausprägt, und die Mitwirkung von Frauen, die im Bereich des Altarraums nicht gestattet war. Musik bei „stillen Messen“, v. a. der Gesang der Gemeinde, wurde als paraliturgisch verstanden (so im Cäcilianismus) und war oft, ohne Bezug auf die liturgischen Texte, eine Parallelfeier zum Geschehen am Altar.
Erst das 2. Vatikanische Konzil ließ die Muttersprache für die Liturgie auch in der katholischen Kirche zu. Es definierte die dem Vorsteher des Gottesdienstes von Amts wegen zukommenden Teile sowie alle anderen liturgischen Dienste (Diakon, Lektor, Kantor/Psalmist, Chor etc.) und erklärte die Kirchenmusik als „einen notwendigen und integrierenden Bestandteil der feierlichen Liturgie“, wodurch die Funktion des Chores aufgewertet wurde. Daraus ergibt sich die Aufgabe, das kirchenmusikalische Repertoire der erneuerten Liturgie anzupassen und jenen Teil des thesaurus musicae sacrae [Schatz der Kirchenmusik], der in der Liturgie keinen adäquaten Platz (mehr) hat, weiterhin im Kirchenraum als außerliturgische Musik, jedoch abgestimmt auf Raum und Anlass und korrespondierend zur Feier des Kirchenjahres zu pflegen.
Während die evangelische Kirchenmusik im 18. Jh. in Deutschland einen Niedergang erlebte und geistliche Musik mehr und mehr nicht liturgisch, sondern konzertant aufgeführt wurde, hatte die katholische in Österreich ihren Platz im Gottesdienst und im Kirchenraum trotz der josephinischen Reformen nie verloren. Sie war Teil einer (nach den Türkenkriegen aufblühenden) Musikkultur, die sich nicht mehr auf Zentren wie Klöster, Höfe und Kathedralen beschränkte, sondern das ganze Land erfasste und zu einer Verbreitung der instrumentalbegleiteten Kirchenmusik führte. Musikalienarchive aus Pfarren und Klöstern, auch solche von den aufgehobenen Klöstern auf Pfarrkirchen übertragene, Chroniken und Berichte belegen, dass es in vielen größeren Pfarren spätestens ab der Mitte des 18. Jh.s K. gab. Das Repertoire vereinheitlichte sich mehr und mehr. In der Besetzung ist der vierstimmige Chor der ideale Normalfall (Landmesse), mit Kirchentrio, Bläsern (üblicherweise 2 Trompeten und Pauken), gelegentlich auch schon mit Bratsche. Diese breite Basis kirchenmusikalischen Lebens schloss die Heranbildung von Sängern und Musikern am jeweiligen Ort ein, so dass man in der folgenden Epoche vom „Dorfkonservatorium“ sprechen konnte. Die Mitwirkung an den örtlichen Chören und Instrumentalensembles war bis in das 20. Jh. für viele später erfolgreiche Musiker der Einstieg in ihre Karrieren.
Aus der Sicht josephinischer Reformbestrebungen war die Kirchenmusik zu aufwendig und dem Wesen des Gottesdienstes nicht gemäß. Daher wurden Einschränkungen verordnet, die Förderung des Gemeindegesangs in der Landessprache mit dem vielfach vom Geist der Aufklärung geprägten „Normalmessgesang“ und „katechetischen Gesängen“ vorgeschrieben, viele Klöster (und damit Zentren der Kirchenmusik) aufgehoben, Prozessionen und Wallfahrten verboten, „Josephinische Pfarren“ gegründet. Nach der Gottesdienstordnung für Niederösterreich vom 27.5.1785 war in Stadtpfarren mit drei oder mehr Geistlichen die Feier des Hochamts am Sonntag „jederzeit mit Instrumentalmusique oder in deren Abgang choraliter ohne Aussetzung der Monstranz und ohne Segen“ erlaubt, an Werktagen in Kirchen, „wo ein ordentlicher Chor ist, täglich eine Choralmesse mit oder ohne Orgel nach Beschaffenheit der Zeit, doch ohne Instrumentalmusik“. Auch die Vesper sollte dort, wo ein „ordentlicher Chor“ existierte, zwischen Christenlehre und Litanei (am Sonntag Nachmittag) choraliter, an größeren Festtagen auch mit der Orgel, jedoch ohne Instrumentalmusik gesungen werden. Diese Regelungen bzw. Verbote sind ein Beleg für die allgemein verbreitete Praxis instrumentalbegleiteter Kirchenmusik. Der „Chor“ war eine fixe Einrichtung. Die Reformverordnungen stießen auf Widerstand, viele mussten zurückgenommen werden. Die aufgestellte Regel, dass die Kirchenmusik der christlichen Demut und Andacht umso besser entspreche, je einfacher sie sei, und daher das einfache Kirchenlied die festliche Kirchenmusik ersetzen sollte, ging an der Mentalität und dem Bedürfnis nach Festlichkeit gerade der einfachen Gläubigen vorbei. Die Gottesdienstordnung wurde außerdem ohne Rücksicht auf die sozialen Folgen eingeführt. In einer Eingabe der Wiener Musiker an den Kaiser beklagen sie die Gefahr, dass 2000 Menschen zu Bettlern würden. Das Ergebnis vieler Verordnungen war bedrückend. Bekannt ist J. Haydns 14-jährige Schaffenspause in der Messenkomposition. Die Paukenmesse von 1796, die erste danach entstandene Komposition, lässt sich als Protest gegen das Verbot von Trompeten und Pauken verstehen.
Zu welchem Zeitpunkt die Oberstimmen von Frauen übernommen wurden, ist im Detail noch nicht untersucht. Tatsächlich scheint dies noch im 18. Jh. mehr und mehr der Fall geworden zu sein, wie aus den Bestrebungen zu erkennen ist, die Mitwirkung auf Frauen, Töchter und Schwestern der Chorregenten einzuschränken. Der Wiener Erzbischof Sigismund von Hohenwart bat 1804 die niederösterreichische Regierung, diese Regelung erneut durchzusetzen. Da der Erfolg ausblieb, wandte er sich 1806 an den Kaiser. Doch auch dessen Verbot blieb wirkungslos. Zwanzig Jahre später stellte ein Ratgeber des Kaisers fest, dass der Gesang in der Kirche Gebet und Andacht fördern solle und Frauen weder beim Gesang des Volkes noch beim Chorgesang von Natur aus ausgeschlossen sein könnten; nur der Missbrauch sei zu verwerfen – womit solistische Darbietungen ausgesuchter Sängerinnen (auch instrumentale Bravourstücke) im Gottesdienst gemeint waren.
Um die Kirchenmusik finanziell abzusichern, wurden ab den 1820er Jahren vielerorts Kirchenmusikvereine gegründet. Die in dieser Zeit aufstrebenden Musikvereine sahen es als ihre Aufgabe an, durch ihre Schulen Musik „bis in die einsamste Dorfkirche“ (Musikverein für Steiermark ) zu fördern. Die kirchlichen Erneuerungsbewegungen in der 1. Hälfte des 19. Jh.s, für die stellvertretend die Namen des Redemptoristen Klemens Maria Hofbauer in Wien und von Bischof Johann Michael Sailer in Regensburg stehen, versuchten dem allgemeinen Trend zur Loslösung der Musik vom gottesdienstlichen Geschehen entgegenzuwirken. Wiederholt finden sich Verordnungen wie jene des Seckauer (Grazer) Bischofs von 1827, „solche Musikstücke und Melodien zu gebrauchen und aufzuführen, die dem Zweck entsprechen und nicht etwa mehr für ein Theater oder einen Tanz geeignet sind“. Es gab aber auch schon Diskussionen über die liturgische Eignung der Messkompositionen der Wiener Klassiker, was eine Generation später zu heftigen Kontroversen zwischen der österreichischen und der deutschen Richtung des Cäcilianismus führen sollte. Chorleiter waren nach wie vor die Lehrer, die in den Normalschulen für die Kirchenmusik ausgebildet wurden. Der Kirchenmusikverein von St. Anna in Wien arbeitete mit dem Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde zusammen und gründete die erste Kirchenmusikschule, die von dem aus Graz berufenen A. Duck geleitet wurde.
Männerchöre, Frauenchöre und (zunehmend) gemischte Chöre gehören zu den Kennzeichen der bürgerlichen Musikkultur, die an manchen Kirchen auch die Kirchenmusik mitbetreute. Die Vereine hatten für das Werden des bürgerlichen Selbstbewusstseins und für die Bildungsinteressen weitester Kreise eine nicht zu unterschätzende Wirkung. Knabenkantoreien bestanden weiterhin u. a. in Heiligenkreuz, Klosterneuburg, an manchen Klöstern bzw. Klosterschulen wie St. Lambrecht, am Salzburger Dom – und (bis heute) in der Hofburgkapelle in Wien.
In der 2. Hälfte des 19. Jh.s erhielten mit der Verbreitung der (pfarrlichen, diözesanen und nationalen) Cäcilienverbände (-vereine) viele K. eine neue organisatorische Struktur. Die Gründung von Chören und Vereinen wurde vom Klerus gefördert. Der Cäcilianismus beeinflusste u. a. durch seine Publikationen und Kataloge das Chor-Repertoire, trug zur Besinnung auf die liturgischen Aufgaben (gegen den Trend zur paraliturgischen Musik) bei und förderte Musik, die auch in einfachsten Verhältnissen ausführbar war. Die Chöre bestanden meist aus 15/20 bis 30 Personen und etwa ebenso vielen Instrumentalisten, wie dies aus Berichten und Mitteilungen der Cäcilienvereine hervorgeht, die auch einen Einblick in das Repertoire und in die Arbeit der Chorleiter und Organisten geben.
Während der strenge Cäcilicanismus den gregorianischen Choral und die klassische Vokalpolyphonie (Palestrina) sowie deren Imitation als Ideal der Kirchenmusik betrachtete, waren in Österreich fast überall auch Instrumentalisten an der Kirchenmusik beteiligt. Bezeichnend für die Bemühung des Cäcilianismus ist eine Verordnung des Seckauer Bischofs von 1879, in der, wie in den meisten kirchlichen Verlautbarungen dieser Zeit, der Standpunkt vertreten wird, die Instrumentalmusik sei in Unterordnung unter den Gesang geduldet, der polyphone Gesang positiv erlaubt, der Choralgesang allein als der eigentlich rituelle Gesang vorgeschrieben. Ebenso gibt es Anweisungen, die Mitwirkung der aufstrebenden Blechharmoniemusik (Blasorchester) in Bahnen zu lenken und den freizügigen Umgang mit „Einlagen“ für Graduale und Offertorium auf die liturgischen Bestimmungen hin zu überprüfen. Klerus und Chorregenten wurden ermahnt, für Ruhe, Ordnung und ein dem Kirchenraum entsprechendes Benehmen „auf der Chorempore“ zu sorgen.
Eine von Josef Gurtner durch das Bundesamt für Statistik durchgeführte, 1936 publizierte Untersuchung zur Kirchenmusik in Österreich dokumentiert die Organisation des Kirchenmusikdienstes (Chorleiter und K., Scholen, Singschulen, Sängerknabenkonvikte und Kirchenmusikvereine), die Musik im Gottesdienst und außerhalb des Gottesdienstes sowie Orgeln und Glocken. Im Zeitraum der Erhebung (Oktober 1932 bis September 1933) gab es an den 3.218 Kirchen in Österreich 2.703 ständige K. (2.484 gemischte Chöre, 137 Frauen- und 59 Männerchöre, 23 Kinderchöre), in weiteren 137 Kirchen wirkten fallweise Chöre mit. 1.602 Chöre musizierten regelmäßig zusammen mit Instrumentalisten, wobei dies in Wien zu etwa 90 % der Fall war, in der Diözese Feldkirch zu 20,5 %. Die 2.703 Chöre hatten insgesamt 39.247 Mitglieder, davon in den Oberstimmen ca. 24.000, darunter 1.100 Knaben, in Tenor und Bass 14.000 (für ca. 1.200 Mitglieder lag keine Angabe der Stimmlage vor). Mehr als ein Drittel dieser Chöre hatte bis zu 20 Mitwirkende, 50 Chöre hatten bis zu 50, 18 bis zu 60, 8 Chöre bis zu 70, 5 bis zu 90, zwei bis zu 100 (davon je einer in den Diözesen Salzburg und Seckau). Es bestanden 14 Sängerknabenkonvikte mit insgesamt 220 Schülern und 135 Vereine. In fast einem Drittel aller Kirchen wurde (auch) gregorianischer Choral gesungen, v. a. im Offizium (z. B. in der Vesper). Entsprechend der österreichischen Tradition konnten sich die instrumentalbegleiteten Ordinariumskompositionen der Wiener Klassiker gegen das Verdikt durch den Cäcilianismus behaupten. Den größten Teil im Repertoire bildeten leichter ausführbare Kompositionen für Chor und Orgel (und gelegentlich auch Instrumente).
In der NS-Zeit (Nationalsozialismus) beendeten viele Lehrer, dem Druck weichend, ihre Dienste in der Kirchenmusik. In der Nachkriegszeit wurde zunächst die Zwischenkriegstradition aufgegriffen. Die Chormusik (auch die außerkirchliche) erfreute sich verstärkter Pflege unter Berücksichtigung zeitgenössischer Komposition (u. a. aus dem Umkreis der Abteilung Kirchenmusik der Wiener Musikakademie und aus dem Musikhaus Doblinger).
Die Liturgiereform des 2. Vatikanischen Konzils beendete mit der Forderung nach Beteiligung der Gemeinde an der gottesdienstlichen Musik die Exklusivstellung der Chöre in der Liturgie und löste Befürchtungen über das Ende des großen, für andere Verhältnisse komponierten kirchenmusikalischen Repertoires aus. Die Spannung zwischen einem weitgehend vorkonziliar geprägten Chor-Repertoire und der erneuerten Liturgie erwies sich jedoch nicht von vornherein als Nachteil, sondern förderte die Entwicklung neuer Aufgaben der Kirchenmusik zwischen Liturgie, Meditation und (geistlichem) Konzert. Die in fast allen Diözesen geschaffenen Bildungsmöglichkeiten für Kirchenmusiker führten zu verstärkter Förderung von Chören.
In einer Erhebung über K. in Österreich Mitte der 1980er Jahre, zwei Jahrzehnte nach der Liturgiereform des Konzils, wurden 1.053 Chöre mit 29.195 Sängern erfasst. Im Vergleich zur Untersuchung von 1932/33 hatte sich das Repertoire entsprechend den neuen gottesdienstlichen Anforderungen verändert, ohne das traditionelle Repertoire der österreichischen Kirchenmusik aufzugeben. Die meisten Chöre bezeichnen sich als K., gelegentlich als „Singkreis“ oder „Motettenchor“. Viele Chöre profilierten sich in Ergänzung zum liturgischen Dienst in (Kirchen-)Konzerten, die bis in die jüngste Zeit mit Skepsis als dem Kirchenraum nicht entsprechend betrachtet werden, sich jedoch in der Gegenwart mehr und mehr als eine (von mehreren) Aufgaben der Kirchenmusik herauskristallisieren. In einem Schreiben der römischen Kongregation für den Gottesdienst von 1987 wird ausdrücklich verlangt, jenen Schatz der Kirchenmusik, der in der Liturgie nicht oder nicht mehr seinen Platz finden kann, in der Musikpflege außerhalb der Liturgie zu erhalten.
Für die Kirchenmusik in der evangelischen Kirche Österreichs, zu der (2002) samt den Tochtergemeinden 265 Gemeinden mit ca. 335.000 Mitgliedern zählen, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg Singwochen zu einer ständigen Einrichtung, ebenso Werkwochen für Kirchenmusik. Die Initiative dazu ging von den evangelischen Einrichtungen in Oberschützen, von der Expositur der Grazer MAkad. sowie vom Referat für evangelische Kirchenmusik beim Oberkirchenrat aus. In der 1980 gegründeten Zeitschrift praxis der kirchenmusik wird regelmäßig über die Kirchenmusik berichtet.
Stärker noch als in der Vergangenheit wird die Arbeit mit Kinder- und Jugendchören gefördert, nicht nur wegen der stilistischen Vielfalt neuer Kirchenmusik z. B. im Bereich des neuen geistlichen Liedes, sondern auch wegen der fehlenden musikalischen Praxis in den Bildungseinrichtungen, v. a. in den Schulen, in denen die aktive Musikausübung gegenüber der Reproduktion durch Tonträger abgenommen hat.
Die kirchliche Chorarbeit sowie der Gemeindegesang haben eine wichtige Funktion für das gemeinschaftliche Singen, welches außerhalb des Kirchenraums keineswegs mehr regelmäßig in Übung ist. Die Feier von Wortgottesdiensten (u. a. auch eine Folge der geringeren Zahl von Priestern) sowie die Pflege von außerliturgischer Musik verändern die Anforderungen an das Repertoire. Die nach wie vor geförderte und beliebte liturgische Einbindung der Werke der Wiener Klassiker in den Gottesdienst von heute macht aber auch Überlegungen zu einer neuen Aufführungspraxis notwendig (Aufstellungsort von Chor und Instrumentalisten, Einbindung der Gemeinde in den liturgischen Gesang, Disproportionen in der Länge einzelner Ordinariumssätze, qualitative Anforderungen, die persönliche Teilnahme der Chorsänger am Gottesdienst u. a.).
Literatur
MGG 2 (1995) [Chor und Chormusik]; H. B. Meyer/R. Pacik (Hg.), Dokumente zur Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung des dt. Sprachgebietes 1981; Die katholische Kirchenmusik im Lichte der Zahlen, bearb. v. J. Gurtner, hg. v. der Österr. Leo-Ges. 1936; R. Flotzinger in C. Floros et al. (Hg.), Hamburger Jb. f. Mw. 8 (1985); MGÖ 1–3 (1995); M. Haselböck in R. Bischof (Hg.), Ein Jh. Wiener Symphoniker 2000; H. Hollerweger, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österreich 1976; Th. Reuter, Evangelische Kirchenmusik in Österreich. Studien zu ihren Organisationsformen und Persönlichkeiten im 20. Jh., mit besonderer Berücksichtigung des Wirkens von Egon Hajek, Diss. Wien 1995; W. Sauer in KmJb 63/64 (1980); E. Tittel, Österr. Kirchenmusik 1961; J. Trummer, K. Österreichs 1987 [m. Lit.verz.].
MGG 2 (1995) [Chor und Chormusik]; H. B. Meyer/R. Pacik (Hg.), Dokumente zur Kirchenmusik unter besonderer Berücksichtigung des dt. Sprachgebietes 1981; Die katholische Kirchenmusik im Lichte der Zahlen, bearb. v. J. Gurtner, hg. v. der Österr. Leo-Ges. 1936; R. Flotzinger in C. Floros et al. (Hg.), Hamburger Jb. f. Mw. 8 (1985); MGÖ 1–3 (1995); M. Haselböck in R. Bischof (Hg.), Ein Jh. Wiener Symphoniker 2000; H. Hollerweger, Die Reform des Gottesdienstes zur Zeit des Josephinismus in Österreich 1976; Th. Reuter, Evangelische Kirchenmusik in Österreich. Studien zu ihren Organisationsformen und Persönlichkeiten im 20. Jh., mit besonderer Berücksichtigung des Wirkens von Egon Hajek, Diss. Wien 1995; W. Sauer in KmJb 63/64 (1980); E. Tittel, Österr. Kirchenmusik 1961; J. Trummer, K. Österreichs 1987 [m. Lit.verz.].
Autor*innen
Johann Trummer
Letzte inhaltliche Änderung
25.3.2004
Empfohlene Zitierweise
Johann Trummer,
Art. „Kirchenchöre‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.3.2004, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001d458
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.