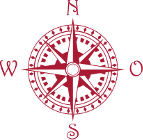Gesellschaftslied
Bezeichnung für die vorwiegend im süddeutschen und österreichischen Raum während des 15. und 16. Jh.s gepflegte Gattung des mehrstimmigen Lieds mit weltlichen deutschsprachigen Texten. Der von Hoffmann von Fallersleben 1844 geprägte Begriff war mit der Vorstellung einer Pflege im häuslichen oder geselligen Rahmen durch das auch als Kulturträger sich etablierende frühneuzeitliche Bürgertum verbunden; das G. wurde deshalb mitunter dem höfischen und dem Volkslied entgegengesetzt. Die zumal im habsburgischen Bereich beobachtbare Verankerung im höfischen Kontext einerseits, die funktionale, thematische und formale Vielfalt andererseits, die den Begriff wenig „trennscharf“ erscheinen lässt, hat in der neueren Forschung teilweise zu kritischer Auseinandersetzung mit dem Terminus geführt. In der Musikwissenschaft ist für das einschlägige Repertoire inzwischen der Ausdruck Tenorlied gebräuchlich geworden. Von einigen in den Trienter Codices überlieferten, am Modell der französisch-burgundischen Chanson orientierten Liedsätzen auf deutsche Texte abgesehen, wird ein größeres Corpus mehrstimmiger deutscher Lieder erstmals in Sammlungen aus städtisch-bürgerlichem Milieu nach der Mitte des 15. Jh.s greifbar (Lochamer, Glogauer und Schedelsches Liederbuch). Das hier etablierte Satzmodell mit einer vom Komponisten übernommenen oder neu geschaffenen Melodie als Tenor-c. f. blieb für die nächsten 100 Jahre verbindlich, nur gelegentlich fungiert der Diskant als c. f.-Träger, so im wohl bekanntesten G. überhaupt, H. Isaacs Innsbruck, ich muß dich lassen (in der posthumen Druckfassung). Als Ausgangspunkt des Tenorliedsatzes, der in der älteren Forschung als spezifisch deutsches Phänomen teilweise Gegenstand nationalistisch überhöhender Darstellung war, gelten heute usuelle Mehrstimmigkeitspraktiken, die unter Einfluss der komponierten Kunstmusik franko-flämischer Provenienz einer Artifizialisierung unterzogen wurden.
Seit dem ausgehenden 15. Jh. sind G.er zu einem erheblichen Teil von Komponisten geschrieben worden, die aus dem österreichischen Raum kamen oder dort (zumindest zeitweise) gewirkt haben, wie E. Lapicida, H. Finck, H. Isaac, P. Hofhaimer, W. Grefinger, St. Mahu, L. Senfl, Arnold v. Bruck, G. Peschin. Charakteristisch für diese Produktion ist die Verbindung mit der Hofkultur. Damit steht in Zusammenhang die Beteiligung franko-flämischer Komponisten bzw. der Anschluss an den Standard der in den Hofkapellen gepflegten franko-flämischen Vokalpolyphonie; die bevorzugte Verwendung sog. Hofweisen als c. f.; die Veranstaltung von Lieddrucken am Beginn des 16. Jh.s durch Hofdrucker und mit höfischem Repertoire (u. a. die Sammlung Erhard Oeglins 1512). Ein die Pflege des G.es begünstigender Faktor war möglicherweise auch der – von Maximilian I. geförderte und prominent etwa von Conrad Celtis vertretene – „national“ ausgerichtete Humanismus.
Beim G. lassen sich zwei formale Grundtypen feststellen: die sog. Barform und die Durchkomposition. Die Textur bewegt sich zwischen den beiden Polen eines mehr oder weniger aufgelockerten Note-gegen-Note-Satzes und eines Satzes mit polyphon verselbständigten Stimmen. Die allgemeinen Entwicklungstendenzen der franko-flämischen Musik werden im G. (wenngleich teilweise mit einer gewissen Verspätung) nachvollzogen: der Übergang von Drei- zu Vierstimmigkeit am Ende des 15. Jh.s, die Erweiterung zu Fünf- und fallweise Sechsstimmigkeit während der 1. Hälfte des 16. Jh.s, v. a. aber die sukzessive Homogenisierung des Satzes bzw. der vermehrte Einsatz der Imitationstechnik bis hin zur konsequenten Durchimitation. Der im 1. Drittel des 16. Jh.s erreichten Angleichung der Stimmen entspricht, dass diese in den Quellen ab den 1530er Jahren sämtlich textiert sind. Bis dahin war meist nur dem Tenor Text unterlegt. Der darauf gestützten Ansicht, das ältere G. rechne mit einer vokal-instrumentalen Mischbesetzung, wurden neuerdings Indizien für eine vokale Ausführung des ganzen Satzes entgegengestellt. Eindeutig belegt ist (u. a. durch Tabulaturen) die rein instrumentale Wiedergabe von G.ern.
Stellt bis ca. 1570 das mehrstimmige deutschsprachige Lied infolge der Bindung an das Tenorprinzip einen relativ fest umrissenen Typus dar, so kommt es danach durch die Aufgabe der Tenor-c. f.-Anlage und eine Öffnung gegenüber Gestaltungsmitteln des Madrigals und der Chanson zu einer Verwischung der Gattungsgrenzen. Eine Schlüsselrolle spielen dabei die – für die folgende Generation modellhaft wirkenden – Lieder von O. di Lasso. Diese Tendenz kündigt sich aber schon in der von W. Schmeltzl 1544 herausgegebenen Sammlung teutscher Gesänge an, die der mehrstimmigen deutschsprachigen Vokalmusik insbesondere unter Rückgriff auf italienische und französische Vorbilder vom Tenorlied abweichende Formen zuführt.
Literatur
MGG 5 (1996, Lied), 1273–1277; L. Nowak, Das dt. G. bei Heinrich Finck, Paul Hofhaymer und Heinrich Isaak, Diss. Wien 1927; L. Nowak in StMw 17 (1930); Ch. Petzsch in Euphorion. Zs. für Literaturgeschichte 61 (1967); L. Finscher in NHdb 3,2 (1990); St. Keyl in Early Music 20 (1992); M. Staehelin in J. Kmetz (Hg.), Music in the German Renaissance 1994; MGÖ 1 (1995), 205–208.
MGG 5 (1996, Lied), 1273–1277; L. Nowak, Das dt. G. bei Heinrich Finck, Paul Hofhaymer und Heinrich Isaak, Diss. Wien 1927; L. Nowak in StMw 17 (1930); Ch. Petzsch in Euphorion. Zs. für Literaturgeschichte 61 (1967); L. Finscher in NHdb 3,2 (1990); St. Keyl in Early Music 20 (1992); M. Staehelin in J. Kmetz (Hg.), Music in the German Renaissance 1994; MGÖ 1 (1995), 205–208.
Autor*innen
Markus Grassl
Letzte inhaltliche Änderung
25.4.2003
Empfohlene Zitierweise
Markus Grassl,
Art. „Gesellschaftslied‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
25.4.2003, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001cf02
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.