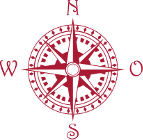Fagott
Doppelrohrblattinstrument. Das Grazer Hofkapellen-Inventar von 1577 verzeichnet u. a.: „Ain guetter fagato, welcher täglichen gebraucht wierdt“ sowie „Mehr ain ganze Copia alte schlechte fagati, darunder zween Baß, drey Tenor vnd zween discant.“ Diese Einträge gehören zu den frühesten Erwähnungen eines wohl um die Mitte des 16. Jh.s in Norditalien entstandenen Doppelrohrblattinstrumentes, welches mit zweifacher Bohrung ausgestattet, bis weit ins 17. Jh. aus einem einzigen Stück Holz gefertigt wurde. Oft wird das frühe F. auch als Dulzian bezeichnet. So trägt ein außergewöhnlich reich dekoriertes Instrument (KHM Wien, Sammlung alter Musikinstrumente, Nr. 117) „Der Dulcin bin ich genant / Nit einem iedem wohl peka[n]t / Der mich will recht pfeifen / Der mus mich wol lerne greifen.“ Die früheste Abhandlung, die Dulziane beschreibt, ist die Prattica di Musica von L. Zacconi, deren erster Teil wahrscheinlich weitgehend während Zacconis Anstellung als Kapellsänger in Graz verfasst, 1592 in Venedig veröffentlicht wurde.Der Dulzian wurde zur Verstärkung des Chorbasses (deshalb oft auch Choristfagott genannt), als Generalbass-Instrument oder für solistische Aufgaben eingesetzt. Zum Teil hochvirtuose Partien finden sich in Werken von J. H. Schmelzer, A. Cesti, A. Poglietti, M. A. Ziani u. a.
Wann und wo sich der Übergang vom einteiligen, im Chorton (Stimmton) gestimmten Dulzian zum vierteiligen, im Kammerton gestimmten barocken F. vollzog, lässt sich heute nicht mehr exakt feststellen. Der konkreteste Hinweis auf Ursprung und Alter der neuen Holzblasinstrumente (Flöten, Oboen, F.e) findet sich in Johann Christoph Denners (1655–1707) am 10.11.1696 beim Rat der Stadt Nürnberg eingereichten Meisterrechtsgesuch. Hier führt Denner, der sich „Haudbois, Haudadous und Fagothmacher alhir“ nennt, an, „Instrumenta“ zu bauen, „die ohngefehr vor 12 Jahren in Franckreich erfunden worden“. Dies deutet auf die frühen 1680er Jahre hin. Im letzten Jahrzehnt des 17. Jh.s fanden die neuen Holzblasinstrumente allmählich Einzug in die musikalische Praxis im deutschsprachigen Raum.
Der offensichtlich früheste Beleg zur Verwendung des vierteiligen F.es in Österreich stammt aus dem Stift Kremsmünster. 1696 sandte Abt Erenbert II. Schrevogl (1634–1703) den Sohn des Stiftsgambisten Matthias Puecher Sigmund und den Mesner Gottlieb Copisi nach Passau, um sie „Hubua und Fagot“ lernen zu lassen. Seit dem Jahre 1697, in welchem ein „F. französisch Ton“ und „12 F. Rohr“ angeschafft wurden, standen beide als Stiftsmusiker in Verwendung. Heute noch erhaltene, sehr frühe Instrumente, z. B. aus den Zisterzienserklöstern Wilhering/OÖ oder Neuberg/St lassen vermuten, dass das barocke F. eine sehr rasche Verbreitung gefunden hat, wenn auch fallweise noch Instrumente älterer Bauart (Dulziane) v. a. in der Kirchenmusik weiter verwendet wurden, wie dies z. B. für Kremsmünster 1710 oder Salzburg, wo C. H. v. Biber um 1735 noch im Chorton gestimmte F.e (offensichtlich Dulziane) in einigen seiner für den Dom bestimmten Kirchensonaten verwendet, belegt ist.
Die frühesten Hinweise für den Einsatz der neuen „französischen“ Holzblasinstrumente am Wiener Hof stammen ebenfalls aus dem letzten Jahrzehnt des 17. Jh.s. Der am 9.6.1697 aufgeführte Trattenimento per musica Le Promesse degli Dei des Hoforganisten F. T. Richter verlangt u. a. Flöten, Oboen und F. Am 19.3.1698, zum Namenstag des späteren Kaisers Joseph I., wurden trotz Hoftrauer Instrumentalkompositionen von J. J. Fux aufgeführt. Vier Flöten, zwei Oboen, F.e, Violinen, zwei Violoncelli und vier Lauten waren daran beteiligt. Hier wird man in erster Linie an Orchesterwerke denken müssen, welche die 1701 in Nürnberg gedruckte Sammlung Concentus musico-instrumentalis enthält. In mehreren Opern und Oratorien Fux’ tritt das F. als überaus bewegliches Solo-Instrument auf. Hauptaufgabengebiet blieb aber, begünstigt durch die deutliche Grundtönigkeit des barocken F.s und die damit verbundene hohe Verschmelzbarkeit, die Verstärkung der Bass-Linie in der Orchester- und Kirchenmusik bis nach 1770. Erst die engere Mensur des „klassischen“ F.s und der damit verbundene hellere Klang sowie die Erweiterung des Tonumfangs in der Höhe ließen das F. zur Zeit der Wiener Klassik zu einem beliebten Soloinstrument werden. Innerhalb der Orchesterliteratur emanzipierte sich das F. vom bloß bassverstärkenden Instrument zum ausdrucksstarken Soloinstrument der Tenor-Lage. Von den zahlreichen Werken für Solo-F. sind besonders zu nennen: W. A. Mozart, F.konzert in B-Dur, KV 186e (191) (1774), Sinfonia concertante KV 297B (= Anh. 9); J. Haydn, Sinfonia concertante für Violine, Violoncello, Oboe, F. und Orchester in B-Dur, Hob. I:105; F.konzerte von J. B. Vanhal, L. Kozeluch u. a., und die große Sonate für F. und Klavier in F-Dur (1807) von Anton Liste (1774–1832). Im weiteren Verlauf des 19. Jh.s verlor das F. (nicht nur) in Österreich als Solo-Instrument an Bedeutung. Erst im 20. Jh. entstanden wieder herausragende Werke für F., z. B. von E. Wellesz (Suite, op. 77 für F. solo), H. E. Apostel (Sonatina, op. 19/3 für F.solo), A. Dobrowolski (F.-Konzert), I. Eröd (Sonata Milanese, op. 47) u. a.
Wurden zunächst Instrumente vornehmlich aus dem oberitalienischen Raum (16./17. Jh.) und aus Süddeutschland (1. Hälfte des 18. Jh.s) bezogen, so entwickelte sich ab der zweiten Hälfte des 18. Jh.s ein reger F.werkstättenbetrieb v. a. in Wien (spätes 18. Jh.: M. Lempp, Th. Lotz; 19. Jh.: Wenzel Bradka, St. Koch, W. Küss, Augustin Rorarius, Martin Schemmel, Johann Stehle, K. Tauber, Johann Tobias Uhlmann, J. Ziegler sen.) und Linz (Carl Doke). Der Wiener F.bau erfuhr v. a. in der ersten Hälfte des 19. Jh.s eine eigenständige Entwicklung. Während man in Deutschland (v. a. Leipzig und Dresden) bestrebt war, klangstärkere Instrumente zu bauen und mit unterschiedlichen Materialien (verschiedene Holzarten, Metall) experimentierte, hielt man in Wien am bewährten Ahorn-Holz fest und versuchte, den warmen und weichen Klang zu bewahren. Um die Lautstärke zu steigern, wurden Wiener F.e bis ca. 1860/70 meist mit ungewöhnlich breit auslaufenden Schallstücken („Stürze“) versehen, oftmals auch mit trichterförmigem Aufsatz aus Messing oder Neusilber. Erst gegen Ende des 19. Jh.s lösten Instrumente aus Deutschland, v. a. solche der Firmen Georg Berthold & Söhne (Speyer) und Wilhelm Heckel (Biebrich) das typische Wiener F. ab.
1821 richtete man am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien eine F.klasse ein, deren erster Lehrer A. Mittag wurde. Im selben Jahr betraute man an der Schule des Musikvereines für Steiermark in Graz Michael Delange mit dem F.unterricht. Zunächst wurden an den österreichischen Konservatorien die 1805 in Offenbach (André) und 1806 in Leipzig (Breitkopf & Härtel) erschienenen deutschen Übersetzungen der 1787 in Paris gedruckten Méthode Nouvelle et Raisonée pour le Basson von Etienne Ozi (1754–1813) verwendet. Mit der allmählichen Ausformung eines typischen Wiener F.typs wurde der Ruf nach eigenständigen Schulwerken laut. Th. Hürth, Nachfolger Mittags am Wiener Konservatorium, stellte für seinen Unterricht eine Schule zusammen, die handschriftlich erhalten geblieben ist. Um 1830 veröffentlichte I. Sauer in Wien eine Neue Scala für den F., für Schulen und zum Selbstunterricht, und 1840 gab J. Fahrbach bei A. Diabelli seine Neueste Wiener F.schule heraus. Erst gegen Ende des 19. Jh.s wurde die heute noch weitgehend verwendete Praktische F.schule von Julius Weissenborn (1837–88), 1887 bei Forberg in Leipzig erschienen, im Unterricht eingeführt.
Heute (2001) sind Klassen für F. an den österreichischen Kunstuniv.en in Wien (M. Turkovic, Stepan Turnovsky), Graz (Krisztina Faludy) und Salzburg (Richard Galler) eingerichtet.
F.e tieferer Lage sind in Österreich sehr früh nachzuweisen. Bereits vor 1590 besaß die Grazer Hofkapelle Erzhzg. Karls II. „ain groß fagat, ain Quint niderer“. Um 1630/40 wurde für das Stift Kremsmünster ein Quartbass-Dulzian (heute Oberösterreichisches Landesmuseum Linz, Mu 217) angeschafft. Der Kremsmünsterer Regens chori P. B. Lechler begegnet uns auch als Komponist einer Canzone aus dem Jahr 1645 für 2 Violinen, Viola und 3 Dulziane, bei welcher der tiefste als Fagotto grosso (Quartbassdulzian) bezeichnet wird. Im Salzburger Dom wurde das große Quart-Fagot noch gegen Ende des 18. Jh.s eingesetzt. Ein kurioses Kontrafagott verwahrt das Museum Carolino Augusteum in Salzburg. Es soll laut Inschrift von Johannes Maria Anciuti 1732 gebaut worden sein. Bauweise und Klappenausstattung deuten aber eher auf ein Erzeugnis späterer Zeit hin. Zu den frühesten Werken mit Kontrafagott-Partien gehören W. A. Mozarts Maurerische Trauermusik, KV 479a (= 477) (1785) und J. Haydns, Die sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuz (Vokalfassung), Hob. XX/2, Die Schöpfung, Hob. XXI/2 und Die Jahreszeiten, Hob. XXI/3. An Kontrafagottbauern aus der Zeit um und nach 1800 seien K. Tauber, der ähnlich wie der Prager Simon Joseph Truska (1734–1809) Kontrafagotte in schlanker Form nach dem F.vorbild baute, M. Lempp, St. Koch, A. Rorarius und C. Doke genannt.
Auch F.e höherer Lage sind in Österreich, wenn auch seltener, nachzuweisen. Das Grazer Inventar von 1577 erwähnt unter den fagati u. a. „drey Tenor vnd zween discant“ und in der Sammlung des Museums Carolino Augusteum in Salzburg befindet sich ein Tenordulzian, der höchstwahrscheinlich im Salzburger Dom gespielt wurde. Der musikalische Einsatz von Tenorfagotten wird dann erst wieder im späten 18. Jh. greifbar. Während W. A. Mozarts Sonate für F. und Violoncello, KV 196c (= 292), deren Echtheit allerdings nicht sicher ist, sowohl auf dem Hochquartfagott als auch auf dem normalen Instrument gespielt werden kann, verlangt das Konzert für Oboe, F. und Orchester in C-Dur von I. Malzat (Hs. in Kremsmünster) eindeutig ein Quintfagott. Die Allgemeine Musikalische Zeitung vom April 1815 berichtet von einem am 21. März desselben Jahres in Wien stattgefundenen Konzert: „Variationen für den Tenor-F. componiert und gespielt von Herrn Czeyka [...]. Der Ton ist sonor und angenehm.“ In den ersten Jahrzehnten des 19. Jh.s stellten die Wiener F.bauer K. Tauber, W. Küss und J. Stehle noch Tenorfagotte her, die fallweise für den frühen musikalischen Unterricht Verwendung fanden. Doch bereits 1840 vermerkt J. Fahrbach: „Der Tenor=F. wird nur für das Solo und gleich dem Quart=F.e selten mehr gebraucht.“
Literatur
(Chronologisch:) Kellner 1956; Federhofer 1967; K. Birsak in Jahresschrift des Salzburger Museum Carolino Augusteum 18 (1972); W. Jansen, The Bassoon 1978; M. Nagy in [Kgr.-Ber.] Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik Uster 1981, 1984; M. Nagy in B. Habla (Hg.), [Kgr.-Ber.] J. J. Fux Graz 1985, 1987; A. E. Roberts, Studien zur Bauweise und zur Spieltechnik des Dulzians, Diss. Köln 1987; G. Angerhöfer in Oboe-Klarinette-F. 5/1 (1990); K. Hubmann in Oboe-Klarinette-F. 5/2 (1990); K. Hubmann in W. H. Sallagar/M. Nagy (Hg.), [Fs.] K. Öhlberger 1992; W. Waterhouse, The New Langwill Index 1993; K. Hubmann in Beiheft 14/1 zu den Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jh.s 1994; MGG 3 (1995); [Kat.] Die Holzblasinstrumente Linz 1997, 1997; Hopfner 1999.
(Chronologisch:) Kellner 1956; Federhofer 1967; K. Birsak in Jahresschrift des Salzburger Museum Carolino Augusteum 18 (1972); W. Jansen, The Bassoon 1978; M. Nagy in [Kgr.-Ber.] Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Förderung der Blasmusik Uster 1981, 1984; M. Nagy in B. Habla (Hg.), [Kgr.-Ber.] J. J. Fux Graz 1985, 1987; A. E. Roberts, Studien zur Bauweise und zur Spieltechnik des Dulzians, Diss. Köln 1987; G. Angerhöfer in Oboe-Klarinette-F. 5/1 (1990); K. Hubmann in Oboe-Klarinette-F. 5/2 (1990); K. Hubmann in W. H. Sallagar/M. Nagy (Hg.), [Fs.] K. Öhlberger 1992; W. Waterhouse, The New Langwill Index 1993; K. Hubmann in Beiheft 14/1 zu den Studien zur Aufführungspraxis und Interpretation der Musik des 18. Jh.s 1994; MGG 3 (1995); [Kat.] Die Holzblasinstrumente Linz 1997, 1997; Hopfner 1999.
Autor*innen
Klaus Hubmann
Letzte inhaltliche Änderung
18.2.2002
Empfohlene Zitierweise
Klaus Hubmann,
Art. „Fagott‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
18.2.2002, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001cd04
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.