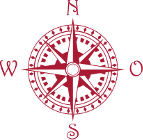Deutschland
Heute Bundesstaat in Mitteleuropa (Hauptstadt: Berlin), umgangssprachlich Bezeichnung für unterschiedliche historische Staatsgebilde.
D. ein für allemal zu definieren ist also nicht möglich. Zunächst fasst man als deutsche eine Gruppe von westgermanischen Sprachen zusammen, von denen die hochdeutsche seit dem 8. Jh. in Schriftdenkmälern vorliegt (Althochdeutsch bis etwa 1100, Mittelhochdeutsch bis gegen Ende des 15. Jh.s, seither Neuhochdeutsch). In diesem Sinne kann mit D. etwa das gemeint sein, was man heute gelegentlich als „deutschsprachige Gebiete“ (das heutige D.,
Österreich, Teile der Schweiz, Minderheiten in mehreren angrenzenden Staaten) zusammenfasst. Im hoch-deutschen Sprachgebiet unterscheidet man mehrere ober- und mitteldeutsche Mundarten. Mit dem Entstehen eines deutschen Königtums (10. Jh.) innerhalb des „Imperium Romanorum et Francorum“, das sich unter Berufung auf die Kaiserkrönung Karls d. Gr. (800) als Fortsetzung des Römischen Reiches sowie als deutsch und universal zugleich verstand, weil es außer D. auch Italien und Burgund umfasste, kam im 11. Jh. die auf D. eingeschränkte Bezeichnung Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation auf (sog. Erstes Reich, bis 1806, anfangs unter wechselnden Kaiserhäusern, seit 1438 den Habsburgern). Die Lehenshoheit des Reiches war jedoch (besonders seit dem 16. Jh.) sowohl durch das zunehmende Erstarken von Regionalfürsten bis hin zur Ausbildung einzelner autonomer Territorialstaaten als auch die Eigeninteressen des Hauses Habsburg gemindert (Loslösung der Schweiz 1499). Daher bestand zu dem unter der Führung Preußens 1871 zustande gekommenen Zusammenschluss der deutschen Staaten ohne Österreich zu einem Kaiserreich (sog. Zweites Reich, bis 1918) kein unmittelbarer Zusammenhang; wohl aber von der Republik D. nach dem Ersten Weltkrieg (1918, sog. Weimarer Republik) zum nationalsozialistischen sog. Dritten Reich (1933–45, ab 1938 mehrere Annexionen). Das heutige D. ist 1990 durch Wiedervereinigung der 1945 von den vier Alliierten aufgeteilten und bis dahin unabhängig sowie ideologisch unterschiedlich entwickelten Staatsgebilden (Bundesrepublik D., Deutsche Demokratische Republik) entstanden. Es liegt auf der Hand, dass das Wort deutsch, noch stärker als der Ausdruck D., jeweils unterschiedlich starke Implikationen politischer Natur enthält, sich z. B. auf den Gebrauch einer Sprache ebenso beziehen wie nationalistische und parteipolitische (z. B. im 19. Jh. „großdeutsch“ versus „kleindeutsch“) Meinungen, ja Vereinnahmungen transportieren kann. Dies von Fall zu Fall auseinanderzuhalten oder gar nachträglich auf die Waagschale der „political correctness“ zu legen ist schwer möglich. Aufgrund der spezifischen geographischen und wirtschaftlich-politischen Bedingungen und in gewissem Gegensatz zu
Frankreich
oder England ist die kulturelle Entwicklung D.s gekennzeichnet durch Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Stämme, Kleingliedrigkeit der geographischen und kulturellen Landschaften und Verstreutheit der kulturellen Zentren, Fehlen eines dominierenden politischen Zentrums, relativ geringe Rolle der Klosterkultur und weitgehendes Fehlen einer Symbiose zwischen Hof und Stadt, große Bedeutung der Handelsstraßen und -städte.In diesem Sinne wird man von einer Musikgeschichte D.s (von der hier kein Abriss, sondern gewisse Hauptlinien für den Versuch einer europäischen Einordnung und damit Klärung des Verhältnisses zu Österreich geboten werden soll) erst ab dem 10. Jh. (ebenso wie der Musikgeschichte in Österreich erst nach bestimmten Differenzierungsprozessen) sprechen. Das ganze Mittelalter hindurch ist D., musikgeschichtlich gesehen, ein Entwicklungsland: Choral und Musiktheorie kommen aus der fränkischen, v. a. karolingischen Kloster- und Hofkultur, aber ihr Nährboden in den deutschen Klöstern ist karg, da sie weniger wissenschaftsorientiert sind. Der Minnesang genannte gesangliche Vortrag stilisierter Liebeslyrik (meist durch professionelle Stellvertreter) hat seine Vorbilder in der provenzalischen Troubadour- und französischen Trouvèrekunst. Durch diese Abhängigkeit ist auch seine Verspätung bedingt (3 Phasen: 1. „Minnesangs Frühling“ 1150–90: der Kürnberger, D. v. Aist, Heinrich v. Veldeke, Friedrich v. Hausen; 2. 1190–1230: Heinrich v. Morungen, Reinmar v. Hagenau, Walter v. der Vogelweide; 3. „Minnesangs Wende“ ab 1230: Neidhart v. Reuental, Reinmar v. Zweter, Gottfried v. Neifen, Tannhäuser, Wizlav v. Rügen; noch später ist meist die Überlieferung in Hss. des 14. oder gar 15. Jh.s). Ebenso verhält es sich mit der artifiziellen Mehrstimmigkeit: spät einsetzend und lange Zeit von Frankreich, England und Italien abhängig. Bei den ersten Eigenkompositionen (als Imitation, nach Rezeption und Kontrafakt) könnte ab dem 15. Jh. den Schulen eine besondere Rolle zukommen. Erst gegen Ende dieses Jh.s setzt eine Entwicklung mit einem gewissen eigenen Profil und sogar Ausstrahlung auf westliche wie südliche Nachbarn ein: Orgelspiel und -komposition. Während z. B. für Conrad Paumann (1410/15–73) ein städtischer (Nürnberg) und A. Schlick ein höfischer (Heidelberg) Hintergrund maßgeblich waren, ist P. Hofhaimer in gewisser Hinsicht ein Grenzfall.
Im Laufe des 16. Jh.s wird eine den gesamten Sprachraum umgreifende, weil zum einen erstmals durch die deutsche Sprache und zum andern durch die religiösen Auseinandersetzungen der Zeit geprägte Musikkultur erkennbar: Das sog. Tenorlied (Gesellschaftslied) blüht v. a. im alemannischen, pfälzischen und bairischen Raum bis fast zum Ende des 16. Jh.s (Lieder-Sammlungen von Erhard Öglin 1512, Arnt v. Aich ca. 1512, Peter Schöffer 1513, Hans Ott 1534–44, Christian Egenolff 1535, Georg Forster 1539–56), das von westlichen Vorbildern sehr viel unabhängiger ist als seinerzeit der Minnesang, aber auch deutlich einfacher als etwa das französische Chanson oder das italienische Madrigal. Seine mit der Volkspoesie noch eng verbundene Gebrauchslyrik ist eher stadtbürgerlich geprägt und korrespondiert mit dem allenthalben festzustellenden, zweifellos konservativ zu nennenden Festhalten am Tenor-Prinzip. Ebenso auf die deutsche Sprache gerichtet ist das durch Martin Luther und andere Reformatoren geförderte, in eigenen Liederbüchern (z. B. sog. Achtliederbuch, sog. Erfurter Enchiridien, Johann Walter 1524, Klug 1529/43, Babst 1545) verbreitete protestantische Kirchenlied (darauf reagiert die katholische Seite mit ebensolchen, z. B. J. Leisentritt 1567, N. Beuttner 1602). Gleichzeitig förderte der neue Glaube die Lateinschulen und die artifizielle Mehrstimmigkeit. Nicht zuletzt von Luthers persönlicher Vorliebe für die frankoflämische Musik der Josquin-Generation her kommt einerseits die Orientierung am jeweils neuesten kompositorischen Entwicklungsstand des Westens (auch was deren rhetorische Geprägtheit anbelangt) und andererseits das Festhalten am cantus firmus-Satz. All diese Momente werden durch Th. Stoltzer in seinen deutschen Psalmmotetten erstmals miteinander verknüpft. Das Prinzip, einen kontrapunktischen Satz aus der emphatischen, gliedernden und abbildenden Deklamation der Worte zu entwickeln, löst der deutschen Sprache gleichsam die Zunge und verwandelt das Modell der lateinischen Psalmen Josquins. V. a. aber ist damit eine über Heinrich Schütz (1585–1672) bis J. S. Bach verlaufende Tradition grundgelegt. Ebenso an die Sprache gebunden, ja eher eine literarische (allerdings weniger an den Minnesang anknüpfend, als meist behauptet) und v. a. soziologische als musikalische Erscheinung der Zeit ist der sog. Meistersang (in Mainz 1315–1600, Augsburg 1449–1772, Nürnberg 1450–1774, Straßburg 1492–1780). Schließlich tritt, weniger von kirchlicher Seite als von höfischen und städtisch-bürgerlichen Kreisen gefördert, gegen Ende des 16. Jh.s die Instrumentalmusik in ein neues Stadium: neben das Solo (Orgel-, Lauten- usw. -Tabulaturen, u. a. von Hans Gerle, H. Newsidler) tritt das mehrstimmige Ensemble, das sich durch Hochstilisierung von der Tanzmusik löst und vom entwickelten Instrumentenbau (Lauten und Gamben: Familie Tieffenbrucker in Füssen, Violinen: Stainer in Absam, Familie Klotz in Mittenwald usw.) ebenso geprägt ist wie vom Variationenprinzip und aufkommenden Generalbass (Valentin Hausmann † 1611/14, P. Peuerl, E. Widmann, Johann Hermann Schein 1586–1630, Samuel Scheidt 1587–1654). Für die Verbreitung all dieser Gattungen kommt neben der Hs. zunehmend dem Notendruck und in jedem Fall das aufstrebende Musikverlagswesen (wiederum Nürnberg an der Spitze: Hieronymus Formschneider, Johannes Montanus-Ulrich Neuber, Paul Kaufmann, Johannes Petrejus, Abraham Wagenmann) Bedeutung zu. Die mit der Reformation begonnenen und in der sog. Gegenreformation fortgesetzten (jedoch keineswegs ausschließlich religiösen) Auseinandersetzungen entluden sich im sog. Dreißigjährigen Krieg (1618–48), der auch an Kulturgütern unerhörte Opfer forderte. Nach dessen Ende dominiert auch in D. durchwegs die höfische Komponente die städtische und lösen in musikalischer Hinsicht italienische die älteren sog. „niederländischen“ Einflüsse ab, während in religiöser und ideologischer zwei nicht deckungsgleiche Trennungslinien erkennbar werden: zwischen dem protestantischen Norden und katholischen Süden einerseits und einer eher französischen als italienischen Orientierung andererseits. Es entstanden zahlreiche größere und kleinere Höfe katholischer, protestantischer und reformierter Konfession (München, Stuttgart, Heidelberg, Dresden, Hannover, Braunschweig, Berlin), die kulturell französisch ausgerichtet sind, während der Kaiserhof zu Wien den Einfluss von dieser Seite aus machtpolitischen Gründen möglichst zu leugnen trachtet. Sie alle sind auch in musikalischer Hinsicht ehrgeizig, was neben der Rolle der Repräsentation auch Konkurrenz untereinander bedeutet. Die Habsburger behaupten ihre Stellung als Kaiser, halten aber die eigenen Länder, auch soweit sie formell zu diesem gehörten, vom Reich bereits fern. Es ist daher eine Frage der Darstellungsinteressen, ob man heute die österreichische Musikgeschichte zu diesem Zeitpunkt noch der deutschen subsumieren will. Jedenfalls sollte nicht übersehen werden, dass, wenn im 19. Jh. von einer gewissen „Führung“ der „deutschen Musik“ die Rede sein wird, die österreichische mit-gemeint ist. D. bleibt jedenfalls zu einem guten Teil rezeptiv und wird gleichzeitig zum Durchreiseland. Das Eigenständige entsteht aus der Rezeption des Fremden. Schütz und Schein sind nicht denkbar ohne venezianische Erfahrungen und Muster, auch wenn sich bei ihnen, zum zweiten Mal nach der Reformationszeit, die gänzliche Anverwandlung des Fremden im emphatischen Sprechen der eigenen, deutschen Sprache ereignet. Aber selbst für die nord- und mitteldeutsche Orgelmusik, einem gemeinhin für besonders charakteristisch und gewichtig angesehenen und in Bach kulminierenden Bereich der deutschen Musik, gilt, dass sie sich aus englisch-niederländischen Ansätzen entwickelte. Ähnlich verhält es sich bei einer anderen, vermeintlich autochthon deutschen Leistung: der lutherischen Kantate Bachs. Sie ist ohne italienische Wurzeln kaum denkbar. Einzigartig sind nicht die Gattung, die poetische oder musikalische Formensprache, sondern Bachs kompositorische Qualität. Selbst diese aber hatte zunächst kaum eine Wirkung über die nächste Generation und über Leipzig hinaus. Erst in dem seit dem frühen 19. Jh. aufgebauten imaginären Museum der Musikgeschichte wird Bach zu einem europäischen Ereignis.
Die so entstandene Vielfalt der deutschen Musikkultur des 18. Jh.s findet ihren beredtsten Ausdruck in der Idee vom „vermischten“ als eigentlich deutschen Geschmack, die bereits bei Georg Muffat 1695/98 vorgebildet ist, v. a. aber durch Johann Joachim Quantz (1698–1773) ihre klassische Formulierung gefunden hat (1752). Seine Utopie, dass diesen vermischten (= deutschen = guten) Geschmack auch die anderen Nationen übernehmen mögen, sollte sich allerdings erst im 19. Jh. und auch ganz anders erfüllen, als Quantz es sich vorgestellt hatte. Es gibt bis zum Ende des 18. Jh.s nur zwei Momente, in denen die deutsche Musikgeschichte zur europäischen wurde: der Emigration G. F. Händels nach England 1727 und der Wirkung der Mannheimer Hofkapelle (J. Stamitz, Alessandro Toeschi ca. 1700–58, F. X. Richter, I. Holzbauer, Anton Filtz 1733–60, und deren Schüler). Aber selbst hier sind Einschränkungen anzumelden: Händel emigrierte, um ein italienischer Opernkomponist zu werden, und die italienische höfische Oper, als ein ganz Europa außer Frankreich umspannendes System, brachte ihn nach London, wo er dann mit der Schaffung des Oratoriums zum englischen Nationalkomponisten werden sollte. Von seinen deutschen Ursprüngen war schon in seiner italienischen Zeit kaum etwas übrig geblieben. Und die Mannheimer waren ein Orchester und eine Komponistengruppe, die ihre besonderen Qualitäten aus ihrer internationalen Mischung (Tschechen, Bayern, Schlesier, Italiener, Wiener) entwickelten. Zu einer führenden Stimme im Konzert der Nationen sollte die deutsche Musik erst im 19. Jh. werden. Große Bedeutung kommt dabei der Frage Wiener Klassik zu. Der Ausdruck stammt aus D., nicht aus Wien. Und kein Zweifel kann darüber bestehen, dass die damit bezeichneten Leistungen nur aus der Stadtkultur der habsburgischen Metropole entstehen konnten. In diesem engeren Sinne sind J. Haydn, W. A. Mozart und auch L. v. Beethoven keine deutschen, sondern eben Wiener Komponisten – so wie Fr. Schubert, A. Bruckner, H. Wolf und G. Mahler Wiener Komponisten waren. Sogar J. Brahms ist als Komponist mehr Wiener als Deutscher, auch wenn er die Gründung des kleindeutschen Reiches feierte und Bismarck verehrte.
Nicht nur seiner Lust an pointierten Formulierungen ist der Hinweis von Carl Dahlhaus entsprungen, in den Jahren um 1790 sei „einer klassischen Musik ohne klassische Musikästhetik eine romantische Musikästhetik ohne romantische Musik“ gegenübergestanden. Darin zeigt sich nicht nur der bereits weit fortgeschrittene Unterschied zwischen Wien und Berlin, dem katholischen Süden und protestantischen Norden, sondern von inzwischen deutlich unterscheidbaren philosophischen Konzepten, für die im einen Fall die Empirie vor der Reflexion rangiert (mit der Konsequenz L. Wittgensteins, die Aufgabe der Philosophie schließlich in der Aufdeckung von Scheinproblemen zu sehen) und im anderen die Abstraktion selbst ohne adäquates Anschauungsmodell entscheidend ist und musikästhetische Konzepte in der Literatur und Philosophie eher gesucht werden als in tönenden Phänomenen. „Nicht die musikalische Substanz selbst, die von [J. A.] Hasse , Graun oder Reichardt stammen konnte, sondern die Gedanken und Gefühle, die von Rousseau, Herder und Jean Paul daran geknüpft worden waren, bildeten für die romantische Musikästhetik, die Wackenroder und Tieck entwarfen, den entscheidenden Anstoß.“ Schließlich sollte die (die Entwicklung in Wien ausklammernde) Kontinuität vom „Sturm und Drang“ (eines C. Ph. E. Bach oder J. F. Reichardt) zur Romantik nicht übersehen werden.
Eher paradox mutet an, dass die deutsche Musik im 19. Jh. gerade wegen ihrer traditionellen Offenheit nach allen Seiten und der Anziehungskraft des bereits stark entwickelten Musiklebens für Immigranten in besonderer Weise ins internationale Blickfeld tritt und vorbildhaft zu wirken beginnt. Dies hängt offenbar mit der Anpassungsfähigkeit der gewonnenen Strukturen an die neue, bürgerlich-städtische Breitenkultur sowie an das gesteigerte Lebenstempo des industriellen Zeitalters zusammen. Die kontinuierlich sich verbessernde und beschleunigende Kommunikation lässt Veränderungen im innerdeutschen Bereich wie solche, die von außen kommen, schneller und weiträumiger wirksam werden als je zuvor. Es bilden sich Strukturen eines spezifisch bürgerlichen Musiklebens, einschließlich der musikalischen Unterhaltungs-Industrie, und verfestigen sich. Entsprechend der Vielschichtigkeit der bürgerlichen Kultur entstehen schichtenspezifische Arten von Musikproduktion und -konsum; zugleich entwickelt sich der Anspruch einer nationalen Musikkultur, jetzt aber nicht mehr im Sinne universalistischer Aufklärung wie bei Quantz, sondern im Gefolge der französischen Revolution und der Nationalromantik, zuletzt als Anspruch auf ausschließende nationale Besonderheit. Kompositionsgeschichtlich bringt die deutsche Romantik als Parallele zum Biedermeier in Österreich einen deutlicheren Schritt über die Klassik hinaus: die deutsche romantische Oper seit C. M. v. Weber und die romantische Instrumentalmusik seit Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–47) und R. Schumann. Dabei ist die französische Weber- und Schumann-Rezeption ein schönes Beispiel für die ironischen Wendungen, deren auch die Musikgeschichte fähig ist: Webers Freischütz, der für Hector Berlioz so wichtig war, ist in seiner Struktur eine (wenn auch von der poetischen und musikalischen deutschen Waldromantik gänzlich überformte) opéra comique, umgekehrt bildet die Rezeption von Schumanns Instrumentalmusik bei Camille Saint-Saëns und seinen Zeitgenossen eine notwendige Voraussetzung für die dezidiert anti-deutsche Programmatik der neuen französischen Instrumentalmusik nach 1871. Um vieles breiter ist die Spur, die Mendelssohns Instrumentalmusik und Oratorien in Europa und sogar darüber hinaus gezogen haben: so, wie sie in D. bis in R. Strauss’ Salome verfolgt werden kann, so reicht sie in Skandinavien, Österreich und Italien bis ans Ende des Jh.s, in England und den USA sogar darüber hinaus. Schließlich bleibt, noch immer kompositionsgeschichtlich gesprochen, die Erfindung der Symphonischen Dichtung durch den gebürtigen Österreicher und nationalisierten Ungarn F. Liszt, der den weitaus größeren Teil seines Lebens in D. verbrachte und v. a. an diese Erfindung den ehrgeizigen, aber letztlich gescheiterten Versuch knüpft, eine zweite, Weltliteratur und Instrumentalmusik miteinander versöhnende „Weimarer Klassik“ (neben der „ersten“ um die Dichter Johann Wolfgang v. Goethe und Friedrich v. Schiller) heraufzuführen. Diese Idee korrespondiert schließlich mit Rich. Wagners Erfindung des Musikdramas und Gesamtkunstwerks (diese beiden Linien auseinanderzuhalten gebietet ihre unterschiedliche Wirkungsgeschichte). So unbestreitbar groß aber auch Wagners musik- und im engeren Sinne kompositionsgeschichtliche Bedeutung ist, so sehr wird sie doch – zumal in europäischem Maßstab – von seiner ideengeschichtlichen Wirkung im Positiven wie Negativen übertroffen. In jeder Hinsicht ist Wagner ein wahrhaft europäisches Ereignis, in seinen Auswirkungen auf Musik, Literatur, Philosophie und Politik wohl nicht einmal von Goethe übertroffen.
Als typisch deutsch wurde auch von Zeitgenossen das im frühen 19. Jh. aufkommende Männerchorwesen (Männergesang) angesehen, das, kompositorisch grundgelegt von M. Haydn und seinem Schüler Weber, abermals v. a. als soziologisches Phänomen zu sehen ist: seine frühdemokratische Rolle im Vorfeld gesetzlich geregelter Vereine auf der einen und die großen Musikfeste (beginnend mit Frankenhausen 1810/11/15) auf der anderen Seite. Daher überrascht auch ihre Wirkung bis in breiteste Schichten (bis in die Dörfer, bestimmte Berufs- und sonstige Gruppen) und schließlich Nachahmung in ganz Europa nicht. In ähnlichem Zusammenhang zu sehen sind auch die nun aufkommenden, aber nur fallweise an ältere Traditionen wie Collegia musica (Collegium musicum) anknüpfenden bürgerlichen Musikgesellschaften (Musikvereine). Ihr wahrhaft aufklärerisches Prinzip war der Zusammenschluß musizierender Männer, gleichgültig ob Dilettanten oder professionelle Musiker sowie ohne Ansehung des Standes, allein zum Zweck gemeinsamen Musizierens und der Sicherstellung eines öffentlichen Musiklebens. Daher wurde auch die Schaffung von Konservatorien als eine (in Frankreich bereits 1795 durch das Directoire verwirklichte) öffentliche Aufgabe angesehen; sie verband sich mit der Idee von der Musik als Bildungsgut und Bildungsmittel. Die größte Wirkung unter den deutschen Konservatorien hatte (gefolgt von Berlin und München) das 1843 auf Betreiben Mendelssohns gegründete Leipziger: hier wurden bis zum Ersten Weltkrieg nicht nur Generationen von Komponisten aus D., sondern auch aus Skandinavien, England, den USA und Ostmitteleuropa ausgebildet (Gade, Grieg, Svendsen, Sinding; Sullivan, Stanford, Delius; Chadwick; Z. Fibich, L. Janácek u. a.). Der von hier ausgehende Einfluss auf die Ausbildung und konservative Verfestigung eines internationalen „akademischen“ Stils, der als deutsch begriffen wurde, aber auch, in Nachahmung und Abstoßung, auf die nationalen Komponistenschulen (Nationalstil) ist kaum zu überschätzen. Kaum weniger wichtig war die Signalwirkung des Leipziger Vorbildes als Erziehungs-Institution, die zu zahlreichen Konservatoriums-Gründungen unter nationalem Vorzeichen in anderen Ländern führte (während die ältesten österreichischen Konservatorien dem Pariser Modell gefolgt waren). Schließlich ist auch die internationale Wirkung der deutschen Musikwissenschaft zu erwähnen, die sich z. T. aus der „Verwissenschaftlichung“ des Univ.smusikdirektoren-Amtes, z. T. durch Außenseiter, entwickelte, die die Methoden der historischen und philologischen Wissenschaften der neuen Disziplin dienstbar machten (O. Jahn und Philipp Spitta waren Altphilologen). Der Aufschwung der Univ.en nach der Gründung des Kaiserreiches kam dem Fach in der Gründung von Instituten und Lehrstühlen wie in der Ausdifferenzierung in (insgesamt dominierende) historische und systematische Musikwissenschaft sowie Musikethnologie zugute. Weltgeltung und Vorbildfunktion der deutschen Musikwissenschaft waren bis 1933 unbestritten. Die Nationalsozialisten trieben viele der besten Vertreter in die Emigration (Exil); die übrigen passten sich an oder zogen sich in die „reine“ fachliche Arbeit zurück.
Die Auseinandersetzung mit dem kompositorischen und literarischen Werk Rich. Wagners prägte, direkt oder indirekt, die Entwicklung der musikalischen Moderne um die Wende zum 20. Jh., in der sich die Weltgeltung der „deutschen“ Musik (die allerdings zu einem wesentlichen Teil Wiener Musik gewesen war) im internationalen Konzert vieler gleichberechtigter Stimmen auflöste – das galt von Claude Debussy in Frankreich bis Béla Bartók in Ungarn, von L. Janácek in Mähren bis Alexander Skrjabin in Russland, und natürlich bis A. Schönberg in Wien und Berlin. Die Entwicklungen in D. nahmen Teil an übergeordneten Prozessen, die meist in anderen Ländern begonnen hatten – insofern bewährte sich noch immer das Talent zur Rezeption. Andererseits spitzten sich diese Prozesse in den deutschen Metropolen, v. a. in Berlin oft radikal zu, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der in breitesten Kreisen als Kulturkatastrophe verstandenen Niederlage im Ersten Weltkrieg und der Revolution von 1918/19. Die „roaring twenties“ boten ein verwirrendes Bild einer opulenten und weitestgehend konservativen musikalischen Hochkultur für das sich schon auflösende Besitzbürgertum, einer von dieser weitgehend isolierten und kaum akzeptierten, ja bekämpften Avantgarde, einer neuen proletarisch-kommunistischen Klassenkultur, kommerzialisierter Jazz-Rezeption, traditioneller Unterhaltungsmusik, musikalischer Jugendbewegung und (unter tätiger Mithilfe der Musikwissenschaft) beginnender Wiederbelebung „alter“ Musik vom Barock bis zum Mittelalter. Bezeichnend für die neue Offenheit gegenüber den verschiedenen Entwicklungen war die Bereitschaft, Komponisten aus anderen Ländern ein Forum für ihre Arbeit zu schaffen, das gelegentllich für sie wichtiger war als die Möglichkeiten in ihrer Heimat; zu nennen sind hier v. a. Österreicher (F. Schreker und A. Schönberg als Lehrer, Alban Berg und E. Krenek als Komponisten). Demgegenüber ist die Zahl der aus weiterer historischer Perspektive wirklich herausragenden deutschen Komponisten dieser Epoche klein: F. Busoni, Carl Orff (1895–1982), H. Eisler, Kurt Weill (1900–50), und v. a. Paul Hindemith (1895–1963), dazu die beiden bedeutendsten Postromantiker R. Strauss und H. Pfitzner.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete diese kulturelle Blüte schlagartig. Die meisten bedeutenden Komponisten und ausübenden Musiker wurden vertrieben, einige emigrierten aus eigenem Entschluss. Zurück blieb eine Anzahl jüngerer, die sich in wechselndem Maße anpassten oder, seltener, in die innere Emigration gingen (Karl Amadeus Hartmann, 1905–63), sowie als Gallionsfiguren des in den Abgrund segelnden Staatsschiffes Strauss, Pfitzner und Orff. Nach der Katastrophe des Dritten Reiches und der Befreiung 1945 wurde der Anschluss an die Gegenwart erstaunlich schnell wiedergefunden, allerdings in den beiden Teilstaaten auf gänzlich unterschiedliche Weise. In der BRD wurde der immense Nachholbedarf an (fast ausschließlich westlicher) zeitgenössischer Musik v. a. vom Rundfunk gesättigt, der von der föderalen Struktur des Staates profitierte und der auch weiterhin eine zentrale Rolle als Mäzen der Avantgarde spielte (Kölner Studio für Elektronische Musik, Donaueschinger Musiktage u. a.). Zu einem Zentrum neuer Entwicklungen, das internationale Ausstrahlung hatte, wurden die schon 1946 gegründeten Internationalen Ferienkurse für Neue Musik in Darmstadt, teils wegweisend unterstützt, teils kritisch begleitet von der tonangebenden Musikphilosophie Th. W. Adornos und seiner vielen Adepten. „Darmstadt“ als demonstrativ internationales Forum, mit den Leitfiguren Pierre Boulez (* 1925), Karlheinz Stockhausen (* 1928) und L. Nono, wurde bis in die 1970er Jahre hinein zum Inbegriff der Dodekaphonie (Zwölftonmusik) und der aus ihr folgenden Entwicklungen, die im Gefolge der Ideen Adornos als die einzig legitime Fortsetzung der Moderne ausgegeben und zunächst weithin auch akzeptiert wurden. Trotz dogmatischer Verengung war das Klima der Entfaltung bedeutender kompositorischer Individualitäten günstig (Hartmann, Bernd Alois Zimmermann * 1918, H. W. Henze, Stockhausen, Dieter Schnebel * 1930, Wolfgang Rihm * 1952). Die Internationalisierung wurde durch die Einwanderung von Komponisten gefördert, die sich in D. zu führenden Köpfen der Avantgarde entwickelten (Maurizio Kagel * 1931, G. Ligeti, Isang Yun * 1917), und später durch die Immigration der bedeutendsten Komponisten aus der sich auflösenden Sowjetunion (Arvo Pärt * 1935, Alfred Schnittke 1934–98, Sofia Gubaydulina * 1931). Schon seit den 1970er Jahren begann sich die Dominanz der Darmstädter „Schule“ in den heute (2001) herrschenden Pluralismus aufzulösen; der Prozess ist beispielhaft abzulesen an der wachsenden Wertschätzung der klassischen Moderne, v. a. Hindemiths. Basis auch dieser Entwicklungen ist die in Europa noch immer einzigartige Vielfalt des nach 1945 rasch wieder aufgebauten öffentlichen Musiklebens mit seinen unzähligen Institutionen und Finanzquellen und seinem musikalischen Spektrum von der Avantgarde über das traditionelle Konzert- und Opernrepertoire bis zur Pop-Szene und der kommerziellen „volkstümlichen“ Musik – nicht zu vergessen die enorme Wirtschaftsleistung der Musikindustrie, die diejenige z. B. der Autoindustrie überflügelt hat.
In der DDR ging der Wiederaufbau des Musiklebens trotz weit größerer wirtschaftlicher Schwierigkeiten ähnlich schnell vonstatten wie in der BRD, aber zunächst ganz unter dem Vorzeichen der staatlich gelenkten Kulturpolitik und der Doktrin des „Sozialistischen Realismus“. Im Vordergrund standen bis in die 1970er Jahre, in wechselnden Konstellationen und mit wechselnd großen Freiräumen, die Rezeption der sowjetischen Musik, die planmäßige Schaffung einer Massenlied- und Oratorien-Kultur und die ideologisch eingeengte Rezeption des musikkulturellen „Erbes“, v. a. Händels, Bachs und Beethovens. Die wichtigsten Köpfe in diesem Prozess waren als Komponist Paul Dessau (1894–1979) und als Komponisten wie Kulturpolitiker Eisler und Ernst-Hermann Meyer (1905–88). In den 1970er Jahren wurde, ganz analog zur Entwicklung in der BRD, ein langsamer und komplizierter Prozess der Entdogmatisierung sichtbar, der sich mit einer wachsenden Öffnung zur westlichen Avantgarde verband; zu den ersten Komponisten, die in der BRD und international Beachtung fanden, gehörten Friedrich Schenker (1891–1966) und Udo Zimmermann (* 1943). Am Ende der eigenstaatlichen Entwicklung 1989 war das Musikleben der DDR nur noch in Nuancen und auf der Ebene der direkt politisch-funktionalen Musik von dem der BRD zu unterscheiden.
Die Fähigkeit der Anverwandlung ausländischer Einflüsse, auch und gerade auf dem Weg der sprachlichen Transformation, zeigt sich ein weiteres Mal in der deutschen Popularmusik seit 1945. Der deutschsprachige Schlager zehrte zunächst von der ungebrochenen Tradition der 1930er Jahre und adaptierte dann alle aus den USA (Amerika) kommenden Moden, die sich mit Tänzen verbanden, von Rumba und Samba bis zum Bossa Nova; nachdem der alles überlagernde Erfolg der Beatles abgeklungen war, begann ab 1973, v. a. durch Udo Lindenberg (* 1946), eine Renaissance des Schlagers im Zeichen einer gemäßigten Rock-Rezeption und einer ebenso gemäßigten (d. h. kommerziell gezügelten) Rezeption politischer Inhalte. Politische Töne waren schon durch die Protestsong-Bewegung aus den USA herübergekommen, modifiziert im Folksong Revival, verstärkt im v. a. vom englischen Punk Rock abgeleiteten Rock der späten 1970er und 1980er Jahre. Heute herrscht die weitgehend gesichtslose und in ihren Inhalten neutralisierte internationale Disco-Kultur, in der die englische Sprache völlig dominiert. Daneben werden in jüngster Zeit in wachsendem Maße politische Positionen durch deutschsprachige Rockmusik markiert, in rechtsradikalen Bands wie im darauf antwortenden „Rock gegen rechts“ (U. Lindenberg, Peter Maffay * 1949). In den teilweise ghetto-ähnlichen Minderheiten-Vierteln der Metropolen haben sich Formen von Musikkulturen ethnischer und sozialer Randgruppen etabliert und vielfache Mischformen ausgebildet, die zum strukturellen Reichtum der gesamten Musikkultur beitragen und ein beträchtliches Entwicklungspotenzial haben.
Literatur
MGG 2 (1995); L. Finscher in U. Prinz (Hg.), Schriftenreihe der internationalen Bachakademie Stuttgart 7 (1997); C. Dahlhaus in R. A. Kann/F. Prinz (Hg.), D. und Österreich. Ein bilaterales Geschichtsbuch 1980; S. Helms (Hg.), Schlager in Deutschland 1972; H. Rösing in H. Bruhn/H. Rösing (Hg.), Musikwissenschaft. Ein Grundkurs 1998.
MGG 2 (1995); L. Finscher in U. Prinz (Hg.), Schriftenreihe der internationalen Bachakademie Stuttgart 7 (1997); C. Dahlhaus in R. A. Kann/F. Prinz (Hg.), D. und Österreich. Ein bilaterales Geschichtsbuch 1980; S. Helms (Hg.), Schlager in Deutschland 1972; H. Rösing in H. Bruhn/H. Rösing (Hg.), Musikwissenschaft. Ein Grundkurs 1998.
Autor*innen
Ludwig Finscher
Rudolf Flotzinger
Rudolf Flotzinger
Letzte inhaltliche Änderung
18.2.2002
Empfohlene Zitierweise
Ludwig Finscher/Rudolf Flotzinger,
Art. „Deutschland‟,
in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung:
18.2.2002, abgerufen am ),
https://dx.doi.org/10.1553/0x0001cb9a
Dieser Text wird unter der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0 AT zur Verfügung gestellt. Das Bild-, Film- und Tonmaterial unterliegt abweichenden Bestimmungen; Angaben zu den Urheberrechten finden sich direkt bei den jeweiligen Medien.